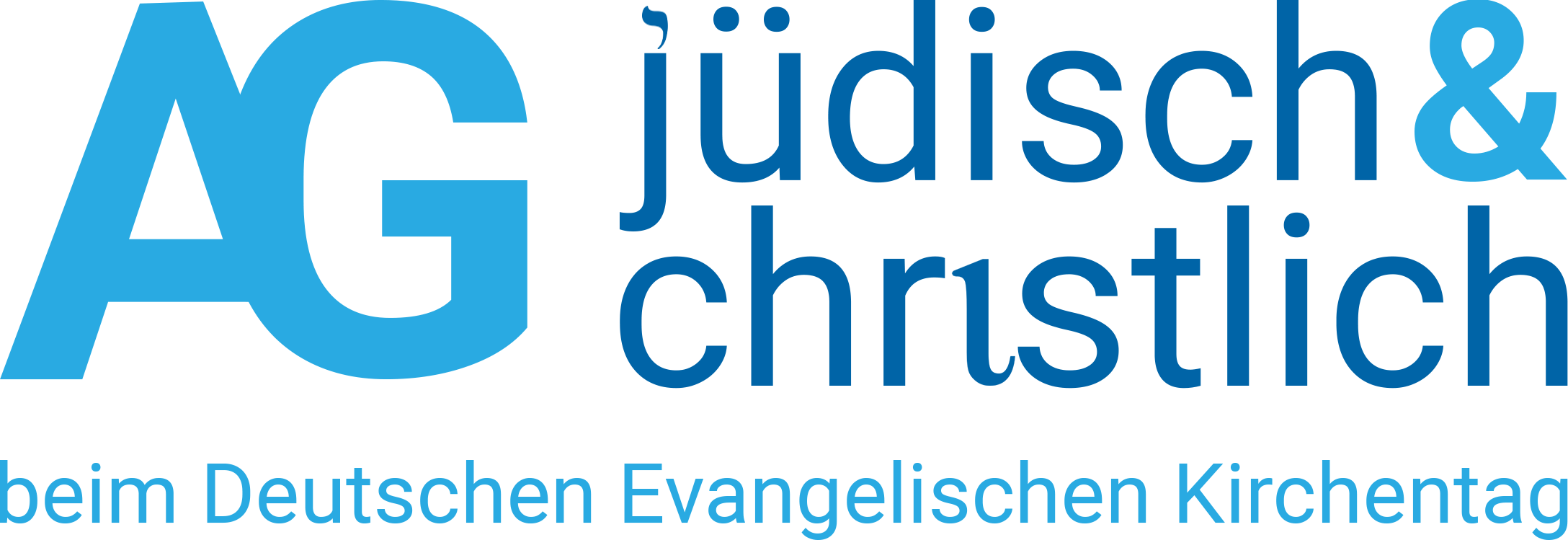Unheilsspuren
Zur politischen Dimension des theologischen Denkens Luthers im Kontext des modernen Antisemitismus
Christian Wiese
1
Die Auseinandersetzung mit der verhängnisvollen Wirkungsgeschichte christlicher Judenfeindschaft und ihrem Zusammenspiel mit dem modernen Antisemitismus gehört zu den Grundelementen christlich-theologischer Selbstreflexion nach 1945.1 Die Erkenntnis der ungeheuren Dimension der Mitverantwortung des Christentums und der christlichen Kirchen für die Verbrechen der Shoah ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem entscheidenden Aspekt theologischer Neuorientierung und zu dem Fundament geworden, auf dem das christliche-jüdische Gespräch der Gegenwart überhaupt erst möglich geworden ist. Die historische Forschung hat das Bewusstsein gefördert, dass die christliche Tradition, der zufolge Israel von Gott verworfen ist, sowie das Verschweigen und Verzerren jüdischen Selbstverständnisses durch die Zeiten hindurch unendliches Leid über jüdische Menschen gebracht haben und mit in die Geschichte des mörderischen Antisemitismus der Nazis hineingehören. Allerdings sind viele Fragen auch strittig – etwa ob man zwischen Antisemitismus als einem Phänomen der Moderne und einem christlichen »Antijudaismus« unterscheiden soll, bei dem es sich aus der Sicht mancher Interpreten um ein rein theologisches Konzept handelt. Ich möchte daher von vornherein betonen, dass sich diese Unterscheidung stets auf dem Grat zwischen einem Mittel geschichtlicher Differenzierung und einer missbräuchlichen Verharmlosung des scheinbar »nur theologischen« Antijudaismus bewegt: Die These, letzterer dürfe – als theologischer Gegensatz zum Judentum – nicht für den Antisemitismus und für die Shoah verantwortlich gemacht werden, war und ist bis in die Gegenwart – auch mit Blick auf Luthers »Judenschriften« – eine der Strategien, sich der Schuldgeschichte von Theologie und Kirche nicht in ihrem ganzen Ausmaß stellen zu müssen. Damit wäre jedoch die konkrete politische Dimension des Theologischen übersehen: Christlicher Antijudaismus war zu keiner Zeit ein »rein theologisches« Phänomen, sondern hat mit seinen Bildern und Mythen stets den konkreten politischen Umgang mit der jüdischen Minderheit bestimmt, sei es unmittelbar oder sei es durch die Prägung einer Mentalität, die Verfolgung, Entrechtung und Gewalt, mindestens aber die Diskriminierung von Juden als selbstverständlich und berechtigt hinnahm. Stets – und so auch bei Luther – waren religiöse, kulturelle, wirtschaftliche und politische Motive auf das Engste miteinander verwoben, nie blieb theologisches Denken über Juden und Judentum ohne konkrete existenzielle Wirkung auf jene, über die man nachdachte.
Muss man deshalb so drastisch urteilen wie der Philosoph Karl Jaspers, der nach 1945 eine Linie von Luther bis nach Auschwitz zog, wenn er mit Blick auf die berüchtigten sieben Ratschläge des Reformators an die Obrigkeit formulierte: »Was Hitler getan, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung durch Gaskammern«?2 Oder wie der Historiker Daniel Jonah Goldhagen, der 1996 in seinem Buch Hitlers willige Vollstrecker Luther als zentrale Figur des von ihm postulierten spezifisch deutschen »eliminatorischen« Antisemitismus deutete, der vom Mittelalter über die Reformation und die neuzeitliche Aufklärung bis hin zur modernen rassistischen Judenfeindschaft mit ihren vernichtenden Folgen führte?3
Die neuere historische Antisemitismusforschung hat, ohne die Mitverantwortung christlichtheologischen Denkens für die jüdische Verfolgungsgeschichte bis hin zur Shoah zu bestreiten, die Frage nach der Kontinuität des modernen Rassenantisemitismus zur traditionellen christlichen Judenfeindschaft wesentlich differenziert. Forscher wie Yehuda Bauer oder Saul Friedländer haben sich auf überzeugende Weise dafür ausgesprochen, von einem differenzierteren Zusammenhang traditioneller und moderner Motive auszugehen: Die biologisch-rassistische antisemitische Ideologie der Nazis bediente sich der tradierten antisemitischen Bilder und Stereotype, verwarf aber vielfach zugleich deren christliche Motivation. Dass sich Antisemiten mit großer Selbstverständlichkeit auf die christliche Judenfeindschaft berufen konnten, ist unbestreitbar und hängt, so Bauer, damit zusammen, dass das Christentum »die Juden in Dogma, Ritual und Praxis mit einem anscheinend unauslöschlichen Stigma brandmarkte«.4 Die historische Antisemitismusforschung geht auf der Grundlage der Prämisse, dass der mörderische Rassenantisemitismus, der in Nazi-Deutschland zu einem präzedenzlosen Verbrechen führte, gegenüber der traditionellen Judenfeindschaft tatsächlich eine neue Qualität aufweist, von einem zweifachen Zusammenhang aus, der auch für die differenzierte Bewertung der Wirkungsgeschichte Luthers von entscheidender Bedeutung ist. Ein Aspekt dabei betrifft die konkreten Zubringerdienste christlicher Theologen, die vor und während der NaziZeit auf dem Hintergrund ihrer theologischpolitischen Überzeugungen zum Antisemitismus und zur Situation der jüdischen Minderheit in Deutschland Stellung nahmen. Dabei spielten Martin Luthers »Judenschriften«, wie zu zeigen sein wird, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zweitens bildete die Tradition der christlichen Judenfeindschaft mit ihrer Sprache und ihren Bildern insgesamt den Hintergrund und das unverzichtbare Arsenal der radikaleren und nun wirklich »eliminatorischen« Formen des Antisemitismus. Mit Saul Friedländers sehr präzisen Worten:
»Vielleicht die stärkste Wirkung des religiösen Antijudaismus war […] die aus dem Christentum ererbte Doppelstruktur des antijüdischen Bildes. Einerseits war der Jude ein Paria, der verachtete Zeuge des triumphalen Vormarsches des wahren Glaubens; andererseits erschien seit dem späten Mittelalter im volkstümlichen Christentum und in chiliastischen Bewegungen ein entgegengesetztes Bild, das des dämonischen Juden, welcher Ritualmorde begeht, sich gegen das Christentum verschwört, der Vorbote des Antichristen und der mächtige und geheimnisvolle Abgesandte der Kräfte des Bösen ist. Dieses Doppelbild kommt in einigen wesentlichen Aspekten des modernen Antisemitismus wieder zum Vorschein. Und seine bedrohliche und okkulte Dimension wurde zum ständig wiederkehrenden Thema der wichtigsten Verschwörungstheorien der westlichen Welt.«5
Eine genaue historische Analyse dürfte zu dem Ergebnis kommen, dass der Reformator in seinen »Judenschriften« zu diesem doppelten, paradoxen Judentumsbild wesentliche Elemente beigetragen hat. Eine Schwierigkeit der Bewertung der Wirkungsgeschichte Luthers besteht allerdings darin, dass die historische Interpretation seiner Haltung gegenüber Juden und Judentum nach wie vor grundsätzlich umstritten ist. Ist das Thema Judentum für Luther nur ein Nebenaspekt oder aber ein Kernstück seiner Theologie? Kann man die Judenfeindschaft, die in seinem Leben immer sichtbarer wurde, von seiner Theologie als zeitbedingte antijüdische Entgleisung abheben, oder handelt es sich um etwas, was in den Grundlinien seines theologischen Denkens verwurzelt ist? Wie ist zu erklären, dass in verschiedenen Phasen des Lebens Luthers auffällig unterschiedliche Stellungnahmen zum politischen Umgang mit der jüdischen Minderheit begegnen? Die Frage nach der Kontinuität oder Diskontinuität zwischen Luthers frühen und späten Schriften wird daher nach wie vor kontrovers diskutiert. Eine Interpretationslinie geht davon aus, Luther habe offenkundig einen dramatischen Wandel durchgemacht: gesellschaftliche Entwicklungen, die Enttäuschung seiner enthusiastischen Missionshoffnungen, persönliche Erlebnisse, das eigene Studium jüdischer Schriften und eine allgemeine Verhärtung des »alten« Luther hätten ihn aus seinen frühen Toleranzträumen gerissen. Eine zweite Deutung, die sich in der gegenwärtigen kirchenhistorischen Forschung durchzusetzen scheint, erblickt dagegen hinter Luthers widersprüchlichen Äußerungen zur zeitgenössischen Politik gegenüber der jüdischen Minderheit eine grundlegende Kontinuität seiner theologischen Bewertung des Judentums, die mit seinem Verständnis der Hebräischen Bibel und seiner Theologie der Rechtfertigung der Sünder zusammenhing.
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist, um mit dem Historiker Heiko A. Oberman zu sprechen, dass die hasserfüllte Auseinandersetzung mit dem Judentum »keine schwarze Sonderseite in Luthers Werk bildet, sondern zentrales Thema seiner Theologie ist«.6 Zugleich scheint eine Deutung ausgeschlossen, die die Position des frühen Luther als eindeutig positive Stellungnahme gegenüber dem Judentum versteht, um das Spätwerk des Reformators als psychologisch oder biographisch begründbaren Rückfall ins Mittelalter erleichtert im Regal zu lassen. Vielmehr besteht die Herausforderung gerade darin, dass zwar die unmenschliche Dämonisierung des Judentums und die unbarmherzigen Ratschläge an die Obrigkeit in Von den Juden und ihre Lügen (1543) und Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Jesu (1543) in Luthers Denken ein neues Element darstellten, die theologischen Motive, die hier zugrunde liegen, sich jedoch durch sein gesamtes Werk ziehen und auch in seiner Schrift Daß Jesus ein geborener Jude sei (1523) präsent sind. Dazu gehören insbesondere die Überzeugung von der Verstockung der angeblich unter Gottes Zorn stehenden Juden und der behaupteten Christusfeindschaft des Judentums, das Unverständnis für eine von der christologischen Schriftdeutung abweichende jüdischen Exegese, das Verständnis der Juden als des Typus der Selbstverherrlichung des sündigen Menschen vor Gott sowie eine apokalyptische Naherwartung, die das Judentum in einer diabolischen Koalition mit Papst, Türken und Schwärmern auf die Seite des Antichrist brachte.
Für ein klares und differenziertes Verständnis der »Judenschriften« Luthers ist auf das ausgezeichnete Buch Thomas Kaufmanns mit dem Titel Luthers Juden zu verweisen. Er betont zunächst mit Recht, dass diese Schriften historisch in erster Linie in ihrem zeitlichen Kontext, also im Zusammenhang der spätmittelalterlichen theologischen Wahrnehmung des Judentums und der damaligen politisch-sozialen Praxis gegenüber der jüdischen Minderheit gedeutet werden müssen. Er spricht zudem in aller Deutlichkeit aus, dass die Judenfeindschaft des späten Luther über traditionelle Elemente des christlichen Antijudaismus weit hinausgeht und zur Verbreitung einer theologisch unkontrollierten Menschenverachtung beitrug, die auch nicht davor zurückscheute, über die Qualität des jüdischen Blutes zu räsonieren, jüdische Christentumsfeindschaft und Mordlust zu behaupten und dämonisierende Mythen wie Ritualmord und Hostienfrevel aufzugreifen – damit habe er sich zum Sprachrohr der finsteren Feindund Angstbilder des spätmittelalterlichfrühneuzeitlichen Antisemitismus gemacht.7 Überzeugend erscheint auch Kaufmanns Deutung, Luther habe damit einen dramatischen politischen Positionswechsel vollzogen – von der Befürwortung einer zeitweisen Duldung der jüdischen Minderheit zum Programm einer »scharfen Barmherzigkeit«, die auf ihre Vertreibung aus dem christlichen Europa zielte. Wichtig ist jedoch dabei, unmissverständlich deutlich zu machen, dass dieser politische Wandel keinen theologischen Positionswechsel bedeutete. Die neuartige Offenheit von 1523, Juden – mit eindeutiger missionsstrategischer Absicht – zu dulden, setzte weiterhin einen fundamentalen Gegensatz zum Judentum voraus, das aus der Sicht des Reformators keine religiös legitime Möglichkeit war, sondern ein wandelnder Leichnam, die Figur des Ahasver. Die Hoffnung auf eine ernsthafte Hinwendung der Juden zum von der Reformation sichtbar gemachten Evangelium bedingte eine Duldung auf Zeit – »bis ich sehe, was ich gewirckt habe«. Auf der Ebene der Theologie ist demnach eine klare Kontinuität zwischen den frühen und den späten Lutherschriften festzustellen.
Ein unübersehbares Kontinuum ist Luthers Schriftbeweis für die endgültige Verwerfung Israels, dessen Leiden er als Folge von Gottes Zorn sieht. Darin kommt die christliche Enterbungsund Verwerfungstheologie klassisch zum Ausdruck, gegen die sich heutige theologische Erkenntnis mit dem Bekenntnis zur »bleibenden Erwählung« Israels wendet. Zweitens ist Luthers exklusiv christologische Sicht der Hebräischen Bibel zu nennen: Er vermochte zu keiner Zeit zu verstehen, dass Menschen sich von ihrem Christuszeugnis nicht überzeugen ließen, und immer mehr wurde ihm das zum Beweis für die angebliche Blindheit der Juden. Dass Juden an ihrem Glauben, ihrer Schriftauslegung und an ihrer Identität festhielten, erschien ihm als Wirkung des »Antichrist«, die jüdische Verweigerung reformatorischer Bekehrungsversuche verstand er als Ausdruck dämonischer Verstocktheit. Drittens ist erkennbar, dass die Juden – auf dem Hintergrund der Rechtfertigungslehre Luthers – zu einem Typus für die Selbstverherrlichung des sündigen Menschen vor Gott wurden. Der Reformator konnte zwar von der Solidarität der Sünder reden: »Die Juden heute sind vor allem wir elenden Christen selbst« (Römerbriefvorlesung). Aber neben dem selbstkritischen Potential steckt in diesem Satz auch ein ganz gefährliches Element: Zuletzt bleibt das Feindbild, sodass man den Juden in sich und die wirklichen Juden bekämpfen muss – die Existenz der Juden in der christlichen Gesellschaft wird etwas Gefährliches und Angstmachendes. Und so verwendete Luther das Bild der falschen, bedrohlichen jüdischen Religion zugleich als Mittel gegen den Katholizismus, innerreformatorische Gegner oder die christlichen Hebraisten, denen er aufgrund ihres Interesses an den jüdischen Schriften »Judaisieren« vorwarf.
Während dieses früh geprägte theologische Bild fortwirkte, verschärften sich die politischen Schlussfolgerungen ins Maßlose. Wie zwiespältig die Wirkung von Luthers Überzeugungen war, wird bereits bei Josel von Rosheim sichtbar, dem Sprecher der deutschen Judenheit zur Zeit der Reformation, bei dem die Schrift von 1523 zunächst große Hoffnung auf eine Verbesserung der Lage der Juden ausgelöst hatte, der aber spätestens 1537 erkennen musste, dass er sich getäuscht hatte: Als er Luther bat, dem Verbot des Aufenthaltsrechts für Juden auf kursächsischem Territorium entgegenzutreten, gab ihm dieser in einem Schreiben an seinen »guten Freund, seine(n) lieben Josel« zu verstehen, er werde sich beim Kurfürsten nicht für die Juden verwenden, um sie nicht durch seine Gunst in ihrem Unglauben zu bestärken. Das Elend der Juden, so Luther, werde kein Ende finden, solange sie nicht aufgehört hätten, Jesus Christus als »gekreuzigten, verdammten Juden« zu lästern. Religiöse Judenfeindschaft hatte in diesem Zusammenhang unübersehbar politische Folgen.
Die lutherische Orthodoxie des 16. und 17. Jahrhunderts schrieb die negativen Züge des Judentumsbildes Luthers weiter, während der Pietismus und die Aufklärung eher die Perspektiven des frühen Luther akzentuierten. Eine dramatische und unmittelbar politisch relevante Wirkung entfalteten Luthers »Judenschriften« jedoch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, als vor allem die Hasstiraden Luthers im Kontext des modernen Antisemitismus eine zentrale Rolle spielten. Daher kommt der Erhellung der Wirkungsgeschichte und Rezeption der Judenfeindschaft Luthers in den Jahrzehnten vor den Schrecken der Judenpolitik der Nazis besondere Bedeutung zu. Das von Karl Barth stammende Bild der »Unheilsspuren« im Titel,8, neben ihren positiven Einund Auswirkungen alle auch wahre Unheilsspuren hinter sich gelassen haben? Wo wäre die Theologie sicher davor, indem sie die Schrift auslegt, Fremdes, ja Gegenteiliges in sie hinein zu legen – indem sie das Eine erkennt, das Andere um so gründlicher zu verkennen […]?«] steht für die bittere Erkenntnis, dass Luthers »Judenschriften« – neben den erschütternd vielen anderen judenfeindlichen Strömungen der christlichen Theologie – Teil der Geschichte des Antisemitismus und der christlichen Schuldgeschichte sind, die das Verhältnis von Judentum und Christentum bis in die Gegenwart überschatten. Mit Blick auf Luther gilt es zu bedenken, dass die Unheilsspuren seiner Urteile über Juden und Judentum in verschiedenen historischen Kontexten unterschiedliche Formen annehmen konnten, wir es also mit einer differenzierten, facettenreichen Wirkungsgeschichte zu tun haben und davon ausgehen müssen, dass das Verhältnis der frühen und der späten »Judenschriften« auf vielfach gegenläufige Weise interpretiert werden konnte.
2
»Es geht hier um keine antiquarische Kuriosität, um keine sonderbare Altersschrulle eines großen Mannes, zu seinem 450. Geburtstag wiedererzählt. Wie damals Martin Luther gegen die Juden losbrach, so tönt es immer wieder aus dem deutschen Volk seit 450 Jahren. Wir erleben im November 1933, daß zahlreiche bedeutende Vertreter der protestantischen Kirche und Lehre sich diese Stellung Luthers ausdrücklich zu eigen machen, ihm Wort für Wort nachsprechen und seine Judenschriften eindringlich zitieren und empfehlen.«35Es fällt auf, dass namhafte protestantische Theologen in ihren Reden den Schwerpunkt zumeist auf Luthers Spätschriften legten und dabei zwar der rassenpolitischen Vereinnahmung von Luthers Judenhass widersprachen, selbst jedoch völkischen Anklängen gegenüber nicht abgeneigt waren. So sprach Heinrich Bornkamm in einem Vortrag über »Volk und Rasse bei Martin Luther« ausdrücklich von Luthers »instinktiver rassenmäßiger Abneigung gegen die Juden«. Er machte zwar deutlich, dessen Vorwürfe gegen das Judentum seien nicht aus dem Rassegegensatz erwachsen, betonte aber umso stärker den religiösen Gegensatz: »Sie (Luthers Anklagen) erklangen vielmehr wider ein Volk, das unausgesetzt Gott durch Unglauben und Lästerung beleidigte.« An dem grundsätzlich religiösen Charakter von Luthers Judenfeindschaft könne kein Zweifel bestehen; allerdings, so fügte Bornkamm hinzu, könne das »Verbrechen der Christuslästerung«, des Ungehorsams gegen die Schrift und des »jüdischen Raubes an Gottes Ehre« alleine Luthers Zorn nicht erweckt haben. Bestärkt worden sei seine Abneigung durch die wirtschaftliche Schädigung und »Aussaugung Deutschlands« durch die Juden.36 Exemplarisch sei an dieser Stelle die Position des Königsberger Lutherforschers Erich Vogelsang angeführt, die dieser 1933 in einer dem Evangelischen Reichsbischof Ludwig Müller gewidmeten Schrift mit dem bezeichnenden Titel Luthers Kampf gegen die Juden entfaltete. Statt den völkischen Lutherinterpreten zu widersprechen, redete er von dem »heute volksnotwendigen Antisemitismus«,37 erklärte sein Einverständnis mit dem sog. »Arierparagraphen« und versagte dem Judentum explizit jede Solidarität. Gegen eine Einebnung des Gegensatzes von Judentum und Christentum, die er der liberalen Theologie seit der Aufklärung vorwarf, prägte er ein, dass das jüdische Volksschicksal nur in den Kategorien »Fluch und Verblendung, Zorn und Gericht Gottes« zu verstehen sei.38 »Das ist der rätselhafte Fluch über dem jüdischen Volk seit Jahrhunderten«, so gab er Luthers Haltung wieder: »In Wahrheit eine Selbstverfluchung. An Christus, dem Stein des Anstoßes, sind sie zerschellt, zermalmt, zerstreut.«39 Anklänge an die Legende vom »ewigen Juden« fehlen ebenso wenig wie die Rede von dämonischen Mächten und einer göttlichen Verwerfung des jüdischen Volkes, aus der keine Emanzipation retten könne. Polemik gegen die »jüdisch-rabbinische Sittlichkeit« – mitsamt all den impliziten antisemitischen Vorwürfen – findet sich bei Vogelsang ebenso wie die Rede von dem im Glauben an die Erwählung Israels und an das Kommen des Messias wurzelnden »unheimlich zähen Weltherrschaftsanspruch des Judentums«40 – und vieles mehr aus dem Arsenal des theologischen wie des Rassenantisemitismus. Vermischt ist dies mit einer Inanspruchnahme Luthers für völkische Kategorien: Der Reformator habe eine Abneigung gegen »alles Landfremde« gehabt, viele seiner sozialen Anklagen gegen das Judentum hätten auch einen »völkischen Klang«, insofern sie sich gegen die »undeutsche Verschlagenheit und Lügenhaftigkeit« der Juden gerichtet hätten.41 Luthers eigentliche Stärke sei die »innere Einigung und Durchformung von Deutschtum und Christentum« gewesen.42 Wie Vogelsang sich die »scharfe Barmherzigkeit« Luthers für die Gegenwart vorstellte, ließ er, wie viele seiner protestantischen Kollegen, die die politischen Konsequenzen ihrer theologischen Argumentation staatlichem Handeln überließen, offen. Dass Vogelsang vor allem Luthers Vorstellungen von einer »reinlichen Scheidung von Juden und Christen« hervorhob, spricht dafür, dass ihm eine Politik der Separation und der Aufhebung der Integration und Gleichberechtigung der deutschen Juden vorschwebte.[Ebd., S. 23.] Dies aber ist kaum anders denn als Legitimation der konkreten staatlichen Entrechtungspolitik der Nazis im ersten Jahr nach ihrer Machtergreifung zu verstehen. In jedem Fall distanzierte Vogelsang sich von Eduard Lamparters im Liberalismus wurzelnden Position: Luthers praktische Lösung der »Judenfrage« heiße keineswegs »Verständigung« oder Angleichung oder freundliche Anerkenntnis, »daß [Zitat Lamparter] auch der jüdischen Religion neben der christlichen ein göttliches Daseinsrecht, eine besondere Gabe und Aufgabe im Geistesleben der Menschheit (heute noch) verliehen ist«. Für die Kirche gelte vielmehr »Scheidung der Geister und entschiedener Abwehrkampf gegenüber der inneren Zersetzung durch jüdische Art, gegenüber allem ‚Judaisieren‘ und ‚Judenzen’«.43 Vogelsangs Position ist ein klassisches Beispiel für eine Form von Judenfeindschaft, die antijudaistische Kategorien mit ausgeprägter soziokultureller Feindschaft gegen die jüdische Gemeinschaft verband und sich gegenüber rassistischen Konzepten zumindest offen verhielt. 1933 und darüber hinaus war dies ein sehr verbreitetes Denkmodell. Das Judenbild, das auf diese Weise Verbreitung fand, war das eines – bedingt durch seine Abkehr von Christus – dem Christentum vollständig fremd und zugleich feindlich gegenüberstehenden Volkes, eines zumindest fremdartigen, wenn nicht fremdrassigen Volkstums, dessen angebliche »zersetzende« Kraft Deutschland bedrohte und nach Gegenmaßnahmen verlangte, was einer stillschweigenden Billigung der Entrechtungspolitik, jedenfalls der Preisgabe der jüdischen Gemeinschaft entsprach. Die »Unheilsspuren« einer antisemitisch verschärften Theologie Luthers lassen sich hier in einem ganz konkreten politischen Versagen gegenüber der Judenpolitik der Nazis verfolgen. Dass lutherische Kirchen und Theologen sich, abgesehen von der unmittelbaren Wirkung der Judenfeindschaft Luthers, auch von einer verhängnisvollen Deutung der lutherischen »Zweireichelehre« haben leiten lassen, die dem Staat programmatisch das Recht zum politischen Handeln gegen die jüdische Gemeinschaft überließ und ihm nicht hereinreden wollte, ist in diesem Zusammenhang nur anzudeuten. Unter Berufung auf Luthers Unterscheidung der beiden Regimente Gottes gaben weite Kreise selbst der Bekennenden Kirche die Juden der »scharfen Barmherzigkeit« staatlichen Handelns preis und beanspruchten allenfalls das Recht zu einem anderen Handeln an den Judenchristen im Bereich der Kirche. Theologisch aber hatten sie der Diffamierung des Judentums nicht wirklich etwas entgegenzusetzen. Das wird, um eine letzte Stimme aus dieser Zeit zu hören, aus einer Position mitten aus der Bekennenden Kirche deutlich. Hans Georg Schroth, der Karl Barths »dialektischer Theologie« nahestand und nach 1945 zur Arbeitsgemeinschaft »Juden und Christen« beim Deutschen Evangelischen Kirchentag gehörte, legte 1936 und 1937 zwei mutige Schriften über Luther und die Juden bzw. über Luthers christlichen Antisemitismus heute vor. Mutig deshalb, weil Schroth darin gegen rassistische Vorbehalte die Berechtigung der »Judenmission« verteidigte, für das Recht eines getauften Juden eintrat, als Pfarrer zu amtieren, und sich intensiv mit der sog. »Ariergesetzgebung« und dem völkischen Antisemitismus auseinandersetzte. Er wollte ein theologisches Wort zur Gegenwart sagen und sich, wie er schrieb, auf Luthers »christlichen Antisemitismus« besinnen, der jedem unchristlichen Rassendenken widerspreche. Luthers »christlicher Antisemitismus« sei missionarisch ausgerichtet gewesen, habe Hoffnung für das Heil der Juden, ziele aber auf die theologische Widerlegung des Judentums. Das Judentum sei für Luther, weil es ständig »Christus lästerte«, auf die Seite des Antichrist geraten. Luther habe aber gewusst, dass die Kirche, das »neue Israel« ständig selbst in Gefahr stünde, »Judentum« zu werden und Christus zu verleugnen. Judentum sei seinem Wesen nach »Antichristentum«: »Der Jude steht immer vor der Tür, auch wenn kein rassisch und politisch sichtbares Judentum mehr bestehen sollte. Und wer wollte leugnen, daß wir heute in der Kirche nicht einen solchen ‚antisemitischen’ Kampf zu fechten hätten?«44 Schroth wollte damit im Grunde etwas Positives aussagen – nämlich dass Christen mit Juden in der Solidarität der Sünde und Abwendung von Christus verbunden seien, ja dass Luthers »christlicher Antisemitismus« sich in der Gegenwart womöglich ebenso stark wie gegen die Juden gegen die Völkischen selbst richte: Entscheidet sich ein Volk gegen Christus, so wird es ein »jüdisches«, »mag es seiner Rasse und seinem Volkstum nach sein, was es wolle, mag seine Religion katholisch, evangelisch oder nichtchristlich organisiert sein. Und wenn ein Volk durch seinen tatsächlichen Entscheid gegen Christus ein Volk des Judentums geworden ist, teilt es das Schicksal des rassischen Judentums: Verwerfung durch Gott.«45 »Es siegt der Jude auch im Antisemitismus, wenn dieser die Frage gegen Christus beantwortet« – deshalb ist es Aufgabe der Kirche, »allem Antichristentum oder völkischnationalem Christentum Widerstand zu leisten, so wie es Luther gegenüber den Juden tat«.46 Wie gefährlich und kontraproduktiv dieser Gedanke eines »heilsgeschichtlichen Antisemitismus« Luthers war, nahm Schroth wohl damals nicht wahr, auch nicht, dass diese verzweifeltverschlungene Argumentation, die im übrigen Luthers Haltung verharmloste und theologisch überhöhte, eine fatale judenfeindliche Denkstruktur fortschrieb, auch wenn sie diese gegen die Nazis richtete: Das Judentum wird zum ewigen Symbol des »Antichrist« und des Teuflischen, alles Teuflische in seinen verschiedenen Formen ist, so der Umkehrschluss, Judentum. Damit aber wird das Judentum zur geistigen Gegenmacht gegen alles Gute, theologisch und ethisch Wahre. Auf diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass auch Schroth kein einziges Wort der Solidarität mit Juden fand und dem Staat das Recht auf eine judenfeindliche Rassenpolitik nicht bestritt, sondern sich streng auf die Verteidigung der Judenchristen beschränkte. Schroths Deutungsversuch ist vor allem deshalb mehr als erhellend, weil er unübersehbar macht, dass selbst mit den besten Absichten auf dem Boden der Theologie Luthers der Bestreitung der – theologischen wie politischsozialen – Existenzberechtigung des Judentums nicht beizukommen war, im Gegenteil, dass sie diese ständig neu inspirierte.
3
Der Beitrag erschien zuerst in der epd-Dokumentation 39 (2015): Reformator, Ketzer, Judenfeind. Jüdische Perspektiven auf Martin Luther. Tagung der Evangelischen Akademie zu Berlin und des Zentralrats der Juden in Deutschland, Berlin 10.-12.6.2015 ( online)
Fußnoten
- Eine ausführlichere Fassung dieser Überlegungen findet sich in meinem Aufsatz »‚Unheilsspuren‘. Zur Rezeption von Martin Luthers ‚Judenschriften‘ im Kontext antisemitischen Denkens in den Jahrzehnten vor der Shoah«, in: Peter von der Osten Sacken (Hg.), Das mißbrauchte Evangelium. Studien zu Theologie und Praxis der Thüringer Deutschen Christen (Studien zu Kirche und Israel 19) Berlin 2001, S. 91-135
- Karl Jaspers, »Die nichtchristlichen Religionen und das Abendland«, in: ders., Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze, 2. Aufl., München 1963, S. 156-166, hier S. 162
- Daniel J. Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin 1996, S. 142 (mit Blick auf Luther)
- Friedländer, Saul, Das Dritte Reich und die Juden, Bd. 1: Die Jahre der Verfolgung 1933-1939, München 1998, S. 97
- Ebd., S. 98
- Heiko A. Oberman, Wurzeln des Antisemitismus. Christenangst und Judenplage im Zeitalter von Humanismus und Reformation, Berlin 1981, S. 125
- Thomas Kaufmann, Luthers Juden, Ditzingen 2014
- Vgl. Karl Barth, Einführung in die evangelische Theologie, Zürich 1962, S. 156f.: »Ist es nicht erschütternd, zu sehen, wie selbst die größten und anerkanntesten Theologen, auch Luther, Zwingli, Calvin
- Ernst Schaeffer, Luther und die Juden (Christentum und Judentum. Zwanglose Hefte zur Einführung der Christen in das Verständnis ihrer wechselseitigen Beziehungen, Serie V: Geschichte der Judenmission), Gütersloh 1917, S. 62
- Theodor Fritsch, Handbuch der Judenfrage. Eine Zusammenstellung des wichtigsten Materials zur Beurteilung des jüdischen Volkes, Hamburg 261907, S. 415f.
- Theodor Fritsch, Der falsche Gott. Beweismaterial gegen Jahwe, Leipzig 101933, S. 192
- Ebd., S. 189
- Ebd., S. 190f.
- Mathilde Ludendorff, Der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller. Ein Beitrag zur Deutschen Kulturgeschichte, München 1928, S. 11
- Martin Sasse, Martin Luther über die Juden: Weg mit ihnen!, Freiburg 1938, S. 2
- Alfred Falb, Luther und die Juden, München 1921, S. 4 und 8
- Ebd., S. 11
- Ebd., S. 24
- Ebd., S. 30
- Ebd., S. 47
- Ebd., S. 53
- Ebd., S. 59
- Ebd., S. 53
- Wilhelm Walther, Luther und die Juden, Leipzig 1921, S. 6
- Ebd., S. 9
- Ebd.
- Ebd., S. 37
- Ebd., S. 39
- Eduard Lamparter, Evangelische Kirche und Judentum. Ein Beitrag zum christlichen Verständnis von Judentum und Antisemitismus, Stuttgart 1928, S. 5
- Ebd., S. 15
- Ebd., S. 17
- Ebd.
- Ebd., S. 59f.
- Samuel Krauss, »Luther und die Juden«, in: Der Jude 2 (1917/18), S. 544-547. Zu den jüdischen Stimmen vgl. meinen Essay zu den jüdischen Lutherlektüren des 19. Jahrhunderts im vorliegenden Heft
- Ludwig Feuchtwanger, »Luthers Kampf gegen die Juden«, in: Bayerisch-Israelitische Gemeindezeitung 9 (1933), Nr. 23, S. 371ff, hier S. 371
- Alle Zitate aus Heinrich Bornkamm, »Volk und Rasse bei Martin Luther«, in: Bornkamm, Volk – Staat – Kirche. Ein Lehrgang der Theolog. Fakultät Gießen, Gießen 1933, S. 5-19
- Erich Vogelsang, Luthers Kampf gegen die Juden, Tübingen 1933, S. 6
- Ebd., S. 18
- Ebd., S. 10
- Ebd., S. 14
- Ebd., S. 31. Dem Judentum solle keine rassische Verachtung entgegengebracht werden, aber: »Menschen und Völker und Rassen sind nicht, wie der Rationalismus der Philosemiten meint, alle gleich wertvoll, gleich an Adel, an Klugheit, an Bejahung, an Kraft« (ebd., S. 12)
- Ebd., S. 32
- Ebd., S. 25
- Georg Schroth, Luthers christlicher Antisemitismus heute, Witten/Ruhr 1937, S. 20
- Ebd., S. 22
- Ebd., S. 22f.
- Nikolaus Schneider, »Das Reformationsjubiläum im Licht des erneuerten jüdisch-christlichen Verhältnisses«, in: BlickPunkt.E: Materialien zu Christentum, Judentum, Israel und Nahost. Sonderausgabe Juli 2014, S. 70-74
- Albert H. Friedlander, »Martin Luther und wir Juden«, in: Heinz Kremers et al. (Hg.), Die Juden und Martin Luther. Martin Luther und die Juden. Geschichte – Wirkungsgeschichte – Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 21987, S. 289-300, bes. S. 297