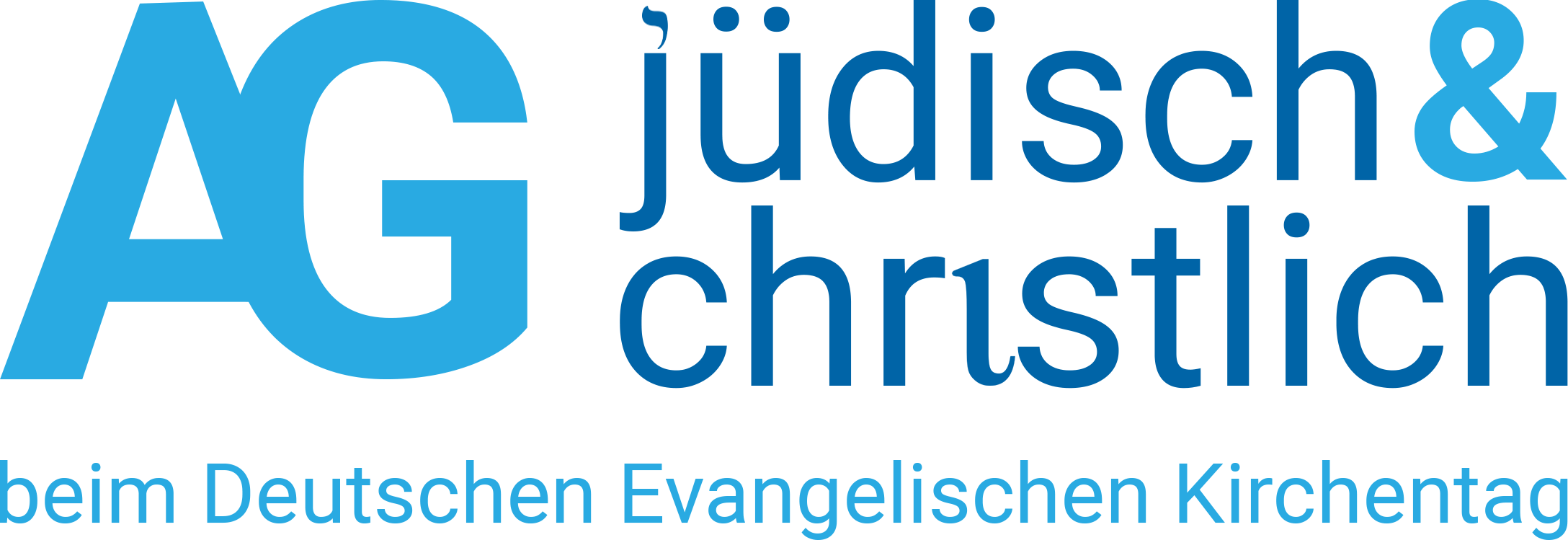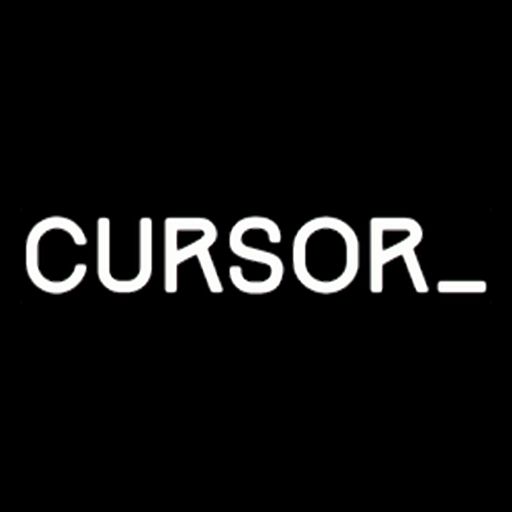Die Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag
Martin Stöhr
1. Von der Notwendigkeit des Verlernens und des Neulernens
1980 fasste eine wohl begründete Untersuchung die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag (im Folgenden: AG) in dem Urteil zusammen: Die christliche Theologie und Kirche sind nach Auschwitz in einer so grundlegend veränderten Situation, dass sie ihre Arbeit in allen Bereichen überdenken und neu bestimmen müssen, nicht nur um dem jüdischen Volk gerecht zu werden, sondern ebenso um ihrer eigenen Sache willen.1 Diese Erkenntnis stand nicht am Anfang der Arbeit der AG, sondern erschloss sich in den ersten Jahren ihrer theologischen Arbeitstagungen in der Ev. Akademie Arnoldshain, (ihrem regelmäßigen Tagungszentrum) und während ihrer öffentlichen Auftritte auf den Deutschen Evangelischen Kirchentagen (im Folgenden: DEKT) seit 1961.2> Weder in der AG noch bei den Kirchentagsveranstaltungen ging es konfliktfrei zu. Wie sollte es auch? Zu vieles an gesellschaftlichen und kirchlichen Traditionen stand (und steht) auf dem Prüfstand.
Der folgende Beitrag versteht sich nicht als eine Chronik der AG, sondern versucht an den wichtigsten Stationen die Notwendigkeit und die zentralen Themen dieser jetzt über vierzigjährigen Arbeit zu benennen. Es ist eine Debatte, die es jahrhundertelang nicht gab. Das jüdische Volk – gleichgültig, ob in Erez Jisrael oder in der Diaspora – lebte nicht im Blickfeld, sondern im toten Winkel einer Christenheit, die sehr wohl sicher über es zu urteilen wusste, aber an Israels3 Selbstverständnis ebenso wenig interessiert war wie an dessen Erfahrungen mit der christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft.4
Nach dem Völkermord war die Frage nicht mehr zu verdrängen, wie die christliche Theologie und die Kirchen ein von ihnen weitgehend produziertes und tradiertes, negatives Bild der Juden, ihrer Kultur, Geschichte und Religion verantworten wollten und könnten. Lehre, Predigt und Katechese der Kirchen (aller Konfessionsfamilien) hatten ein Doppeltes bewirkt: Einmal die Stigmatisierung des jüdischen Volkes zum dunklen Hintergrund des eigenen Lichtes und zum anderen – daraus erwachsend – eine verweigerte Hilfeleistung in den Zeiten, als es verfolgt wurde, oft genug durch eben diese Kirchen. Diese konnten Israels Leiden als göttliche Strafe für die Ablehnung des Messias Jesus deuten.
Von vornherein verstand sich die Bemühung der AG als unentbehrlichen Beitrag zu einer öffentlichen Theologie. Sie umfasst die Breite des biblischen Zeugnisses von der Schöpfung bis zur Vollendung der Welt, von der Befreiung Israels aus der Zwangsarbeit in Ägypten, von der Berufung Israels in den Bund Gottes, den dazugehörenden Weisungen Gottes, von der prophetischen Gesellschafts- und Selbstkritik und der messianischen Hoffnung.
Die Wirkung eines solchen Denkens war innerhalb wie außerhalb der Kirchen spürbar. Es folgte einer Art von self-fullfilling-prophecy: Was man den Juden vorwarf, war nicht deren ureigenste Rolle und Selbstverständnis, sondern eine aufgezwungene Rolle – Zeugen unserer Wahrheit und ihrer Bosheit zu sein, so der Kirchenvater Augustinus. Dieser Satz wurde in den Jahrhunderten eines christlichen Staatskirchentums zur quasi gesetzlichen Grundlage, der Juden (wie christlichen Ketzern) einen minderen Rechtsstatus, ja Verfolgung brachte.
Von vornherein verstand sich die Bemühung der AG als unentbehrlichen Beitrag zu einer öffentlichen Theologie. Sie umfasst die Breite des biblischen Zeugnisses von der Schöpfung bis zur Vollendung der Welt, von der Befreiung Israels aus der Zwangsarbeit in Ägypten, von der Beru- fung Israels in den Bund Gottes, den dazugehörenden Weisungen Gottes, von der prophetischen Gesellschafts- und Selbstkritik und der messianischen Hoffnung. Die AG diskutierte die Ergebnisse ihrer Studientagungen ebenso intensiv wie kontrovers. Sie präsentierte sie öffentlich in den großen Veranstaltungen des DEKT. Zum ersten Mal 1961 auf dem Berliner Kirchentag mit einer unerwartet großen Resonanz unter den Besuchern und in den Medien.
Hinter allem stand die Einsicht, dass Kirchen und Theologie nicht nur jedermann Rechenschaft zu geben haben, über den Grund der Hoffnung, die in ihr ist (nach 1Petr 3,15), sondern auch die Tatsache, dass die Verfolgung und schließliche Vernichtung des europäischen Judentums in aller Öffentlichkeit propagiert, vorbereitet und exekutiert wurde, und dass in diesem historisch singulären Vorgang Theologie und Kirche im Wesentlichen stumm und passiv blieben. Dass die anderen Wissenschaften und gesellschaftlichen Systeme sich nicht besser verhielten, entlastet niemanden. Die wenigen Ausnahmen der Menschen, die öffentlich oder heimlich protestierten oder Juden halfen, dürfen nicht vergessen werden.
Die AG ist weder eine Einrichtung von theologischen Fakultäten noch von Kirchenleitungen, sondern eine Initiative von Nichttheologen, sog. Laien, und Theologen, die außerdem Wert darauf legen, wie der Kirchentag auch, dass die Freiheit und Eigenständigkeit der AG im Namen zum Ausdruck kommt. Eine Besonderheit ist bis heute konstitutiv: Es sollte nach Jahrhunderten einer gegenläufigen Theoriebildung und Praxis in der Kirche und in der Theologie nicht über die Juden, sondern mit den Juden gesprochen werden. Das war nicht einfach durchzusetzen. Und das in einem Land und in einer Situation, die nach der Schoa gekennzeichnet ist durch die Ermordung oder Vertreibung der jüdischen Gemeinden und der vollständigen Zerstörung aller ihrer Einrichtungen. Die wenigen Überlebenden, die aus Lagern, Verstecken oder Exil zurückgekehrt waren, sahen ihre erste Aufgabe im Aufbau der vernichteten Gemeinden und elementarer Strukturen, die jüdisches Leben in Deutschland wieder möglich machen oder – mindestens in gleicher Intensität – eine Auswanderung nach Israel und in andere Länder vorbereiten sollten.
Wer konnte da an einen »Dialog« von Jüdinnen und Juden mit Christinnen und Christen denken, die eben jenen Kirchen angehörten, die zur Judenverfolgung, selbst zur Verfolgung ihrer eigenen, getauften, aus jüdischen Familien stammen- den Mitgliedern, geschwiegen hatten? War Dialog nicht eine sanftere Form der Mission, die ihrerseits die unsanfteren Zwangsdisputationen des Mittelalters abgelöst hatten, also eine Bedrohung des jüdischen Lebens als eines jüdischen Lebens? Kam diese Gesprächsbereitschaft nicht zu spät, weil nach der Gesprächsverweigerung und nach einer Herrschaft tödlicher Gewalt? Hatten die Kirchen für eine Verhältnisbestimmung zum jüdischen Volk eine andere Kategorie zur Verfügung als die der Mission, die allen Völkern und Religionen der Welt in gleicher Weise das Evangelium von Jesus Christus zu bringen hatte – ohne Rücksicht darauf, dass man die eigene Botschaft vom Gott Israels und aller Völker mitsamt seiner Ethik und der Hoffnung auf sein messianisches Reich vom jüdischen Volk und seinen Heiligen Schriften gelernt hatte?
Eine pluriforme Rede vom »Absolutheitsanspruch« des Christentums ist die Folge dieses Denkens, das entgegen dem biblischen Zeugnis Israel in die Reihe der »großen« Weltreligionen einebnet, zu denen das Christentum in Äquidistanz wie zu allen anderen sich begreift und verhält. Die singuläre Beziehung, die die Kirchen (und, wenn auch anders, der Islam) zu ihrer Mutterreligion hat, existiert sonst zu keiner anderen der Weltreligionen.
Früh schon war in der Kirchengeschichte eine Verhältnisbestimmung von Kirche und jüdischem Volk entstanden, die die Kirchen längst an den Platz Israels in Gottes Heilsgeschichte gesetzt hatte. Israel war angeblich von Gott verworfen, weil es seinen Messias abgelehnt, ja gekreuzigt hatte. Verschiedene Enterbungstheorien, in Verbindung mit Gott zugeschriebenen Straftheorien, führten zu der in den Kirchen aller Konfessionen dominant gewordenen Auffassung, nach Ostern sei die Kirche »das wahre Israel« und habe als Israel »nach dem Geist« das Israel »nach dem Fleisch« ersetzt. Zahllose Darstellungen in der bildenden Kunst predigen diese Vorstellung eines überholten, ausgemusterten Volkes ebenso wie entsprechende Texte – oft in den Worten der Hebräischen Bibel! – in Liedern, Gebeten und Liturgien. Der damit verbundene Vorwurf schob Israel ein enges, nationales und partikularistisches Verständnis des göttlichen Handelns zu, während die Kirche sich selbst Universalität und Offenheit bescheinigte.
Unwissen, Halbwissen und Deutungskategorien, die nicht nach dem Selbstverständnis derer fragten, deren Leben und Glauben, deren Kultur und Geschichte einfach einer fremden Deutungshoheit unterworfen wurden, bestimmten ein Bild vom Judentum, das mit dessen Lebenswirklichkeiten nichts gemein hat. Der erste Verstoß gegen das Bilderverbot besteht darin, sich nicht nur ein Bild vom anderen zu machen, sondern dieses nur monochrom und monolithisch auszumalen – »die« Juden.
Ein berechtigter Stolz gerade der protestantischen Theologie, die historisch-kritische Forschung, wurde im Blick auf die Vielfalt des nachbiblischen, jeweils zeitgenössischen Judentums kaum angewendet. Man sprach vom Spätjudentum und meinte das frühe Judentum der Zeit des Zweiten Tempels. Man erforschte und beschrieb die jüdische Vielfalt zur damaligen Zeit, verwandte aber keine Mühe auf das, was über die Juden, das Gesetz, die »Gesetzlichkeit«, das Gewicht der Schriftlichen und Mündlichen Offenbarung, die messianische Hoffnung gesagt und geschrieben wurde, im Gespräch mit den Vertretern der reichhaltigen Palette jüdischer Strömungen, Schulmeinungen und Lebensformen in der zeitgenössischen Gegenwart zu überprüfen, und gegebenenfalls zu falsifizieren oder zu verifizieren.
Johannes und Paulus, reduziert auf ihre vermeintlich »judenkritischen« Sätze, wurden zu Kronzeugen gegen ihr Volk, obwohl – das brachte der Tübinger Neutestamentler Otto Michel in die AG-Debatte ein – es sich beispielsweise bei der Polemik zwischen Paulus und Petrus, beides christusgläubige Juden – um eine auch schon innerjüdisch praktizierte Debatte (»Gruppenpolemik«, »Familienstreit«) handelte. Paulus, als Exponent einer Völkermission, vertrat eine innerjüdische Position wie Petrus: Der eine verlangt nicht die Übernahme der nur Israel gegebene Tora der Beschneidung und der Kaschrut, wenn Heiden, Gojim, Menschen aus den Völkern als »Gottesfürchtige« zum Judentum kamen, der andere erwartete das sehr wohl. Der Galaterbrief und die Apostelgeschichte spiegeln diese im frühen Christentum leidenschaftlich geführte Auseinandersetzung, als seine ersten Gemeinden oft noch jesusgläubige Teile der jüdischen Gemeinden waren.
Die Benutzung jüdischer Argumente aus einer innerjüdischen Diskussion durch Nichtjuden ist deswegen eine prekäre Angelegenheit, weil hier Propheten, Jesus, Johannes, Paulus oder Petrus vereinnahmt, ja enteignet werden. Wenn Jesus einerseits gegen die Pharisäer polemisiert, dann setzt er eine innerjüdisch längst geübte Kritik fort, betreibt sie andererseits aber ausdrücklich auf der nicht bestrittenen Basis »Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet; aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln (Mt 23,2f). Johannes hält auf der einen Seite fest Das Heil kommt von den Juden (Joh 4,22), um auf dieser Basis in den heftigen Streit einzugreifen, der um das wahre Erbe der Abrahamskindschaft im Gang war, gerade in Zeiten, in denen von ihm und seinen Nachfolgern ein messianischer Anspruch mit messianischen Zeichen gelebt wurde. Der Jude Jesus nennt grob, wie viele Dispute verliefen, die jüdische gegnerische Partei Teufelskinder (Joh 8,44), eine Benennung, die er auch Petrus an den Kopf wirft. (Satan, Mt 16,23). Petrus erwuchs für seine kirchliche Karriere daraus kein Schaden, den Juden sehr wohl. Für die AG waren diese Beispiele Anlass für eine kritische Skepsis gegenüber einer einfachen Benutzung von Bibelversen. Sie waren in einigen Beispielen zu bloßen Belegstellen für Dogmen geworden, die eigene biblische Botschaft nur in einer Richtung kanalisierte. Es galt, ihren Sitz in der Geschichte Israels zur Kenntnis zu nehmen wie ihren zweiten »Sitz im Leben«. Und der ist eine judenfeindliche Wirkungsgeschichte.
Es sollte nach Jahrhunderten einer gegenläufigen Theoriebildung und Praxis in der Kirche und in der Theologie nicht über die Juden, sondern mit den Juden gesprochen werden.
Was religiös überliefert war, wurde in ihrem Fall zum feindlichen, ja tödlichen Etikett. Es war zur religiösen Ausgrenzung und Diffamierung ebenso brauchbar wie zur politischen. Sich für antijüdische Äußerungen einen jüdischen Kronzeugen zu instrumentalisieren, ist eine heute noch nicht ausgestorbene Unsitte. Bei der Auseinandersetzung um die Politik israelischer Regierungen lieben Nichtjuden diese Methode auch. Julius Streicher, der Herausgeber des Hetzblattes »Der Stürmer«, ließ ein Kinderbuch drucken, das nur eine Aussage des Johannesevangeliums, nämlich 8,44, ausdrücklich zitierte.
Zu den durchgehenden Aufgaben der AG gehört bis heute, den Zusammenhang zwischen christlicher Judenverachtung und der aus biologischem, völkischem, wirtschaftlichem, fremdenfeindlichem und alltäglichem Denken bestehenden Judenverachtung zwar in ihren einzelnen Argumentationen und spezifischen Gefährlichkeiten präzise zu unterscheiden, aber nicht voneinander zu trennen. Sie schlugen und schlagen immer zusammen. Das neueste Programm für 2005 in Hannover nimmt sich explizit den islamistischen Juden- und Israelhass vor. Wie religiöser Antijudaismus mit säkular daherkommendem Antisemitismus koaliert, so tun es beide mit anderen Vorurteilen rassistischer, ideologischer oder nationaler Provenienz. Scharfe Grenzziehungen sind nicht möglich. Auch deswegen nicht, weil ein religiös sich begründender Antijudaismus den längsten Vorlauf an Judenverachtung und juden-feindlichen Klischees in allen Kulturen und Ländern produzierte, die einer christlicher oder islamischen Prägung unterliegen.
Hier wurde ein Boden vorbereitet, der auch nach dem Wegfall religiöser Argumente und Einstellungen gefährlich bleibt. Säkular, bis ins Sprichwörtliche lebt weiter, was religiös (nur einst?) gelehrt und gelernt wurde. Das lässt sich an den Beispielen belegen, wie »pharisäisch« als Schimpfwort für verlogenes Reden und Handeln, wie die Rede vom »alttestamentarischen Gott der Rache«, vom brutalen Gesetz »Auge um Auge, Zahn um Zahn« zur gängigen Münze wurde. Es zeigt sich pure Ahnungslosigkeit im Blick auf die jüdische Reformbewegung der Pharisäer und die kritische innerjüdische Debatte um sie, im Blick auf das Doppelgebot der Liebe aus dem Alten Testament sowie auf die mit dem Hinweis auf Augen und Zähne geltende Entschädigungsregel anstelle von Blutrache. Was sich in christlichen Schulbüchern, Curricula, Predigten und Lehrbüchern heute langsam durchzusetzen beginnt, erreicht eine heute religiös fast ungebildete Öffentlichkeit, vor allem die Gestalter der öffentlichen und veröffentlichten Meinung, kaum noch. Die Korrektur christlicher »Irrlehren« kommt nicht nur für die Opfer der Schoa zu spät. Sie kam auch nach dem Traditionsabbruch einer christianisierten Gesellschaft für die sich säkularisierenden oder in Religiositäten unterschiedlicher Couleur abdriftenden Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zu spät.
Diese Beobachtungen zur Themenvielfalt in der AG führten dazu, dass die thematische Bandbreite der Arbeit der AG sehr umfangreich werden musste und sich nie nur auf innerkirchliche oder innertheologische Aspekte und Adressaten beschränken konnte, wie auch dazu, dass diese Arbeit zunächst stärker die Öffentlichkeit er- reichte als die theologischen Fakultäten und die Kirchenleitungen. Die Wirkung auf diese war eine indirekte, wenn auch – wie die inzwischen zahlreichen Erklärungen der Kirchen und theologische Publikationen zeigen – eine nicht ganz wirkungslose.
Wichtig ist aber eine Feststellung, die nicht verharmlost werden darf: Entgegen dem christlichen Grund aller Erkenntnis des Glaubens und der Theologie, der mit dem Verweis auf »Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift« angezeigt wird, waren es die historischen Fakten von Auschwitz, der Schoa, die ein langsames Umdenken in der Kirche und in der Theologie in Gang setzten. Es kommt einer Denunziation gleich, dieser Arbeit den Vorwurf zu machen, sie betreibe eine Geschichtstheologie, die geschichtliche Tatsachen als Offenbarungsquellen installiere. Es geht darum, eine ehrliche und kritische Antwort auf geschichtliche Erfahrungen derer zu geben, mit denen Gott als mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat. Ihm verdankt die Christenheit nicht nur die Grundbegriffe ihres Glaubens, sondern mit diesem Volk teilt sie den größten Teil ihrer Bibel, ebenso den Glauben an Gott, den Schöpfer, Erhalter und Erlöser des Lebens, die messianische Hoffnung und eine biblische Ethik, die Jesus zwar kritisch ausgelegt und ausgelebt, aber nie verworfen hat.
Der Umfang dessen, was zu verlernen, ist sehr groß. Zur Beurteilung jeder zeitgenössischen Theologie hatte Johann Baptist Metz seinen Studierenden geraten, jede theologische Arbeit zu prüfen, ob die Theologie, die ihr kennen lernt, so ist, dass sie vor und nach Auschwitz die gleiche sein könnte; wenn ja, dann seid auf der Hut! 5 Dieses verantwortungsvolle Wächteramt nahm und nimmt die kleine AG wahr.
2. Die Anfänge der AG Juden und Christen
Die Evangelischen Kirchentage haben eine doppelte Tradition. Einmal sind sie im Namen, nicht in der Sache identisch mit den im 19. Jahrhundert stattfindenden Versammlungen protestantischer Notabeln. In einer Zeit staatlichen Kirchenregiments kamen auf verschiedenen Ebenen des kirchlichen Lebens Kirchentage synodalparlamentarischer Art zusammen, die sowohl die öffentliche Entfaltung des sozialen und theologischen Erbes der Reformation wie die Einheit einer kleinstaatlich zergliederten protestantischen Kirche vertraten. Im demokratischen Revolutionsjahr 1848 fand der erste Deutsche Evangelische Kirchentag in Wittenberg statt. Er gewann sein bleibendes, wenn auch – gegenüber dem »Kommunistischen Manifest« desselben Jahres – begrenztes Profil durch Johann Hinrich Wicherns Aufruf zur »Innern Mission« und zum Ernstnehmen der sozialen Frage.
Zum anderen gehören zu den »Vorfahren« der neuzeitlichen Kirchentage die im Kirchenkampf der Nazizeit von der Bekennenden Kirche veranstalteten »Evangelischen Wochen«. Hier wurde, nicht zuletzt durch die Beteiligung ausländischer Referenten, gesellschaftliche Verantwortung und mehr oder weniger deutlicher Widerspruch zu Maßnahmen der Partei und des Staates öffentlich eingeübt. Die Frage nach der Diffamierung und Verdrängung der Juden (auch der getauften!) spielte auf deren Themenliste leider keine Rolle. Sie schien nicht zur den Aufgaben einer um ihr Recht und ihre Freiheit kämpfenden Kirche zu gehören. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis schweigt dazu wie das »Darmstädter Wort« von 1947, das der Bruderrat der Bekennenden Kirche veröffentlichte. Dieses nannte zwar eindeutig alle Rahmenbedingungen der deutschen Diktatur mit ihrer Kernideologie eines rassistisch-völkischen Judenhasses: Nationalismus, Feindbildproduktion, Militarismus, Demokratieverachtung und Gleichgültigkeit gegenüber der zum Reich Gottes gehörenden Gerechtigkeit.
Ein 1948 dann nachgeschobenes Wort »Zur Judenfrage« sprach sich gegen Antisemitismus aus, redete aber ungeniert von Israel in den alten Kategorien eines überlegenen, missionarischen Christusbekenntnisses. Israels Leiden seien eine Strafe für die Ablehnung Jesu als des Messias, den allein richtig, nämlich absolut und exklusiv, verstanden zu haben, zum noch nicht hinterfragten Lehr- und Praxishaushalt aller Kirchen gehörte.
Seit dem ersten Kirchentag der Neuzeit, 1949 in Hannover, wurde versucht, die Frage, wie Theologie und Kirche sich zu Israel verhalten, als Thema auf die Tagesordnung der großen protestantischen Treffen zu setzen. Treibende Kraft war der wegen der NS-Politik aus dem Staatsdienst ausgeschiedene Jurist und Diplomat Adolf Freudenberg. Er war nach einem theologischen Studium Pfarrer der Bekennenden Kirche geworden, musste 1939 emigrieren, wurde vom späteren Generalsekretär des im Entstehen begriffenen Ökumenischen Rates der Kirchen, Willem Visser t‘Hooft, mit der Leitung der Flüchtlingsarbeit in Genf beauftragt. Dort kam es zu einer bemerkenswerten Zusammenarbeit – über den gleichfalls aus Berlin vertriebenen Freund und Juristen Gerhard M. Riegner – mit dem ebenfalls neu aufgebauten Jüdischen Weltkongress. Besonders wichtig war ihm und seinen Helfern die Fluchthilfe für Juden aus dem besetzten Frankreich.
Freudenberg versuchte zunächst im Kontakt mit dem »Ausschuss für Dienst an Israel«, in dem sowohl frühere judenmissionarische Aktivisten und Theoretiker, wie der Münsteraner Leiter des dortigen Institutum Iudaicum, Karl Heinrich Rengsdorf (aber auch spätere Mitglieder der AG wie Robert Raphael Geis und Ernst Ludwig Ehrlich) zusammenkamen, wie über Helfer für verfolgte Juden, z.B. den württembergischen Pfarrer Fritz Majer-Leonhard, das Thema in das Programm des Kirchentages zu bringen. Es kam zu nicht mehr als zu »Freundestreffen« im kleinsten Kreis der wenigen Interessierten. Weder der Kirchentag noch der genannte Ausschuss waren zu einer öffentlichen Behandlung der Frage zu be- wegen, welche Konsequenzen denn die Kirchen aus dem Versagen gegenüber dem jüdischen Volk zu ziehen hätten. Angst vor der sich abzeichnenden Notwendigkeit, theologische Konzepte, ihre Inhalte und ihre Sprache zu revidieren?
Freudenberg blieb hartnäckig. Er hatte durch seine ökumenische Tätigkeit in Genf die US- amerikanische und britische Arbeit der »Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit« kennen gelernt und an den Bemühungen teilgenommen, im Vorfeld der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam theologisch neue Ansätze zu formulieren. Dazu gehören auch die sog. Seelisberger Thesen des 1947 gegründeten Internationalen Rates der Juden und Christen (ICCJ). Nach der Rückkehr aus dem Exil wurde er bald evangelischer Vorsitzender der neu gegründeten Frankfurter Gesellschaft für Christlich-jüdische Zusammenarbeit (CJZ) und der entsprechenden Dachorganisation, des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR).
Es darf in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden: Auch die persönliche Erfahrung einiger engagierter Reformer wurde zu einem existenziell wie intellektuell mitbestimmenden Faktor, sich an einer Suchbewegung zu beteiligen, die nach einer alternativen, nicht zu Ungunsten des Judentums neuen Selbstverständnis der Christenheit. Die Betreffenden waren per Gesetz und mit Gewalt als »nichtarisch« oder »jüdisch versippt« definiert, einer eliminatorischen Verfolgung ausgesetzt und von den Kirchen allein gelassen worden wie die jüdische Bevölkerung. Das gilt z.B. für Frau Else Freudenberg, geb. Liefmann, Dietrich Goldschmidt, Helmut Gollwitzer, Hans-Joachim Iwand, Hans-Joachim Kraus, Heinz-David Leuner, Fritz Majer-Leonhard und Lili Simon, später aktive Mitglieder der AG.
Für einige von ihnen schien klar, dass der wiederkommende Christus der ist, den die Christenheit »schon« kennt, die Juden also eigentlich nur einen »christlichen Messias = Christus« erkennen und anerkennen können. Diese christliche Gewissheit hatte sich im Kirchenkampf auch dadurch noch befestigt, dass im Gefolge der Theologie Karl Barths, aber auch der anders gedachten Christologien Rudolf Bultmanns (Mitglied der Bekennenden Kirche) und Paul Tillichs (mit Martin Buber der erste 1933 aus der Frankfurter Universität vertriebene Hochschullehrer), sich eine christozentrische Denk- und Redeweise durchgesetzt hatte.
Sie fand einen wirkungsstarken Ausdruck in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934. In ihr trug das eine Wort Gottes exklusiv den Namen Jesus Christus, das wir zu hören, dem, wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Neben diesem einen Wort hat die Kirche keine anderen Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anzuerkennen. Weder der 30. Januar 1933 noch die Macht der Partei und des von ihr übernommenen Staates, weder ein »Führer« noch eine Rassenlehre sind für Christen verbindliche Autoritäten.
Dieses exklusive christliche Bekenntnis bewährte sich (wie das leider in Barmen nicht erwähnte Erste Gebot und das Gebot, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, Ap.Gesch 5,29) auf der einen Seite als naziresistente Widerstandsposition, verstärkte andererseits im Schweigen über die Juden einen »imperialen« und universalen Anspruch des christlichen Glaubens. Christlich couragierte Dissidenten sahen angesichts der Nazi-Ideologie die Aufgabe nicht, den Dissens zwischen Kirche und jüdischem Volk als einen geschwisterlichen zu verstehen und dementsprechend geschwisterlich mit ihnen in der Zeit ihrer höchsten Gefährdung umzugehen.
Fragt man nach den Neuansätzen, so ist nicht zu übersehen, dass in der Theologie Karl Barths der Gedanke der bleibenden Erwählung Israels breit ausgeführt war. Barth hatte 1934 wegen Eides- verweigerung seinen Bonner Lehrstuhl verloren, zusammen mit dem Neutestamentler Karl Ludwig Schmidt, dem Gesprächspartner Martin Bubers im ersten und letzten Lehrhausgespräch am 14.1.33 vor der deutschen Machtübergabe an die Nazis.
Eine andere Erbschaft hatte der 1945 im KZ Flossenbürg ermordete Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hinterlassen. Nach dem Boykott jüdischer Geschäfte hatte er in einem Vortrag »Die Kirche vor der Judenfrage« ein Eingreifen der Kirche verlangt, wenn eine Gruppe von Menschen rechtlos gemacht oder durch zu viel »Recht« (Sondergesetze) stranguliert werde. Dann habe die Kirche den Staat nach der Legitimität seines Handelns zu fragen, sich nicht nur für die eigenen Mitglieder einzusetzen und »dem Rad in die Speichen zu greifen«, d.h. politischen Widerstand zu üben. 1941 hatte er, schon in der Illegalität, darauf hingewiesen: Die abendländische Geschichte ist nach Gottes Willen mit dem Volk Israel unlöslich verbunden, nicht nur genetisch, sondern in echter unaufhörlicher Begegnung. Der Jude hält die Christusfrage offen… Jesus war Jude.
Schuld zu erkennen, zu benennen und zu bekennen – ohne ein Schielen nach der Schuld der anderen – war seine Forderung. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hatte 1950 sowohl ein Schuldbekenntnis ausgesprochen wie die nicht aufgehobene Berufung Israels zum ersten Mal in einem kirchenamtlichen Dokument bekannt.6
Es waren schmale Ansätze, die in die bescheidenen Neuansätze nach 1945 einflossen. Noch waren sie oft vermischt mit traditionellen Aussagen, die in exklusiven Theologien und Kirchen keinen oder kaum Raum ließen für das lebendige Gottesvolk. Dessen eigene Bemühungen, den Juden Jesus und seine Botschaft aus seinem nie aufgegebenen, streitbaren und innovativen Leben in und mit diesem Gottesvolk zu verstehen, wurden nicht wahrgenommen. Zu denken ist hier beispielsweise an die Arbeiten von Joseph Klausner Jesus von Nazareth (1922) oder an Leo Baecks nicht angenommenes Gesprächsangebot von 1938 in seinem Buch Das Evangelium als Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte. Auf Gleichgültigkeit traf vor der Schoa diese inhaltlich gefüllte Bereitschaft, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu sprechen.
Für den DEKT 1959 in München, die einst so genannte »Stadt der Bewegung«, meinte das Kirchentagspräsidium dem Thema nicht mehr ausweichen zu können. Nach den Absagen der Freunde Albert Schweitzer und Martin Buber, wurden durch den Kirchentagspräsidenten Klaus von Bismarck der Alttestamentler Walter Zimmerli und der systematische Theologe Helmut Gollwitzer gebeten, das Thema zu behandeln.
Zimmerli war sich bewusst, dass – nehmen Christen das Alte Testament ernst – sie unbequeme Fragen von den Juden hören werden: Hat die christliche Gemeinde jene Bußbereitschaft,…die aller eitlen Selbstgerechtigkeit und allem eitlen Kirchenstolz absagt? Weiter: Ist Christus wirklich die Erfüllung des Wortes, das wir vom Alten Testament zu uns reden hören? Dann müsste, wer in ihm ist,…den Kampf um das leibhaft gestaltete Leben, bis hin zum Kampf um die Institutionen des gerechten Lohnes, der Fürsorge für die Schwachen, der Entmachtung der Großmacht Geld« aufnehmen. Zimmerli unterwirft die christliche Rede von der »Erfüllung« biblischer Verheißungen dem biblisch-jüdischen Kriterium. Es geht um eine leibhaftig, den materiellen Sektor des Lebens real und öffentlich verändernde Wirklichkeit. Dieses Kriterium weist den »Messianischen«, d.h. den Christen, den Platz eindeutig bei den Armen an.
In vielen christlichen Auffassungen und Zirkeln macht man allerdings seine christliche Identität noch heute an einer Position fest, die ihr Profil als Antiprofil zum jüdischen entfaltet. Eine authentische christliche Position scheint für viele unauflöslich mit einer Negation des Judentums verbunden zu sein.
Helmut Gollwitzer weist auf die zwei Hilfen hin, die die Christenheit in eine neue Richtung ihres Denkens und Glaubens führen müssen: Einmal die Erinnerung an das, was von deutscher Seite begangen worden ist…und zum anderen die neue Wirklichkeit des Staates Israel. Vernichtung aus einem christlichen Land und Neuanfang im Land der Väter. Die beiden »Hilfen« blieben innerhalb und außerhalb der bald entstehenden AG immer Kernpunkte kontroverser Debatten. So gewiss Gollwitzer auch die Frage hörte, ob an unserem Christentum etwas dran ist, so gewiss war ihm auch, dass durch ein wahrhaft christliches, liebe- volles, vorurteilfreies Handeln der Name Jesu Christi für die Juden zu einem Segensnamen wird,…der durch die Christen zu einem Fluchnamen geworden ist. Er ist auch für die nach Römer 9-11 bleibend erwählten Juden den Juden zuerst und den Griechen (Röm 1,16) die Erfüllung aller biblischen Verheißungen. Das ist bei Gollwitzer die Hoffnung auch für Israel. Eine Vorstellung, die Israel und Kirche nebeneinander/miteinander der Vollendung der Welt und der Geschichte entgegengehen und sich beim selben Ziel treffen lässt, dem Messias Jesus.
Diese Vorstellung liegt nahe bei der überlieferten christlichen Auffassung (die nicht die von H. Gollwitzer ist), dass die Geschichte zumindest für das jüdische Volk nicht mehr offen ist. Ihm ist entscheidend die Judenfrage eine Christenfrage, nach der These von Wladimir Solovjevs gleichnamigem Buch (1881), fragt also nach der Christlichkeit der Christen und Kirchen, nach der der Christusnachfolge. Bemerkenswert war im Münchener Auftakt, dass die reale Geschichte, sowohl die des Völkermordes wie die des nach fast zweitausend Jahren neu wieder erstandenen Staates Israel, als relevant für das Leben und Denken der Kirchen dargestellt wurden.
Immer gab es einen jüdischen und einen christlichen Vorsitzenden, um zu verdeutlichen, auf gleicher Augenhöhe miteinander umzugehen. Das überwand keineswegs die Asymmetrie.
Gegenüber allerlei kulturprotestantischen oder staatsfrommen Anpassungsprozessen des deutschen Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert war die Konzentration auf das Christusbekenntnis, sowohl in Aufnahme altkirchlicher wie reformatorischer Sprache, eine deutliche Profilierung und ein Identitätsgewinn auf christlicher Seite. Zugleich wurde die Notwendigkeit, überkommene christologische Vorstellungen neu zu formulieren und allen antijüdischen Inhalten und Wirkungsgeschichten eine Absage zu erteilen, durch den Christozentrismus deutlich erschwert. Jesus der Christus musste als Prophet, Sohn, Knecht, Lamm, Menschensohn des Gottes Israels begriffen werden. Er ist aus dieser Geschichte des biblischen Gottes nur herauszulösen, wenn die neuen (christlichen) Zweige am alten, aber lebendigen Ölbaum Israel sich aus dieser lebendigen Verwurzelung in Israel selber abschnitten – sie taten es, entgegen dem wirklich neu entdeckten Text aus Röm 9-11. Paulus beschreibt in diesem Ölbaumgleichnis das erst endzeitlich aufgelöste Geheimnis der Geschichte. Das mehrheitlich jüdische Nein zu Jesus, dem Christus, schuf die positive Chance, dass die Völker durch ihn Zugang zum Gott und seinem Bund mit Israel haben, ohne dass Israel sein Erbe in diesem Prozess der Bundesöffnung verliert. Es war Friedrich- Wilhelm Marquardt, der diese befreiende Interpretation vortrug.
Ich weise auf die christologische Akzentuierung unter den christlichen Gesprächspartnern deswegen hin, weil diese Position zu einer scharfen Kontroverse 1963/64 in der AG zwischen Helmut Gollwitzer, Günther Harder und Adolf Freudenberg auf der einen und Robert Raphael Geis und Ernst Ludwig Ehrlich auf der anderen Seite führte. Es gehört zur Stärke der AG, dem notwendigen, schmerzlichen Streit nicht ausgewichen zu sein, nicht einem Ideal der Harmonie, des Synkretismus oder des geringsten gemeinsamen Nenners verpflichtet zu sein.
In vielen christlichen Auffassungen und Zirkeln macht man allerdings seine christliche Identität noch heute an einer Position fest, die ihr Profil als Antiprofil zum jüdischen entfaltet. Eine authentische christliche Position scheint für viele unauflöslich mit einer Negation des Judentums verbunden zu sein. Sie schließt dann logischerweise eine defizitäre Position für die Juden ein. Diese denkt explizit oder implizit: Noch sind die Juden nicht so weit, wie wir Christen (wenn auch gewiss nicht als beati possidentes, aber doch als beati) schon zu sein meinen. Ein hoffnungsloser Zug kennzeichnet ein Christentum, das vollmundig von einer Erfüllung spricht, die sie weltflüchtig nur in innerlichen oder jenseitigen Rettungen verwirklicht sehen will.
Es sollte sich herausstellen, dass die Christologie das Thema ist, an dem sich vor allem entscheidet, ob ein christliches Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, also dem Messias, möglich ist, das nicht auf Kosten des Judentums geht. Gelingt das nicht, dann steht ein Kernargument für Judenmission, die Gollwitzer, wie die die gesamte AG, dezidiert ablehnt, als Hindernis zwischen Juden und Christen. Vor allem dank der theologischen Arbeiten von Hans-Joachim Kraus, Friedrich- Wilhelm Marquardt und Bertold Klappert wurde diese »Überlegenheitschristologie« überwunden. Die beiden Ersten waren wie Geis, Eleonore Sterling, Gollwitzer, der Direktor des Max-Planck- Institutes für Bildungsforschung, Dietrich Goldschmidt, die Juristen Barbara Just-Dahlmann oder Helmut Just, prägende Vorsitzende der AG; Marquardt schrieb für den deutschsprachigen Raum jene erste, radikal neue Interpretation der christlichen Dogmatik, die nicht judenfeindlich ist. (Vergleichbares tat der amerikanische, anglikanische Theologe Paul van Buren). Unter den Exegeten sind hier Günther Harder, Peter von der Osten- Sacken und Rolf Rendtorff zu nennen, die wie Heinz Kremers zu denen gehörten, die durch ihre Forschungen, Lehren und Publikationen schließ- lich auch die theologischen Fakultäten inspirierten, sich wenigstens hier und da den unabweisbaren Fragestellungen zu öffnen.
Gollwitzers und Freudenbergs Drängen auf eine ständige VI. Arbeitsgruppe des DEKT (neben Familie, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Mensch, Ökumene) führte endlich auf dem Berliner Kirchentag 1961 zum Erfolg. Gollwitzer lädt 35 Männer und Frauen ein, darunter 6 Juden, die in eigenständiger Planung und Regie bis heute (natürlich in vielfach geänderter Zusammensetzung) das Programmfeld des DEKT »Juden und Christen« gestalten. Unter den Eingeladenen waren von jüdischer Seite Schalom Ben Chorin, Jerusalem; Ernst Ludwig Ehrlich, Basel; Robert Raphael Geis, Düsseldorf; Paul Holzer, London; Eva Gabriele Reichmann, London; Eleonore Sterling, Frankfurt/M; Kurt Wilhelm, Stockholm – vier aus dem Ausland, in das sie eine deutsche Ausrottungspolitik getrieben hatte, zwei aus dem Exil zurückgekehrt.
Die Asymmetrie im Verhältnis zwischen Christen und Juden betraf nicht nur die Zahl. Es waren auch die Geschichte, die Verkündigung und die Praxis der in einer Attitüde von Macht, Mehrheit und Überlegenheit gegenüber dem Gottesvolk auftretenden Kirchen. Würde sich das abbauen lassen? Immer gab es einen jüdischen und einen christlichen Vorsitzenden, um zu verdeutlichen, auf gleicher Augenhöhe miteinander umzugehen. Das überwand keineswegs die Asymmetrie. In den Anfängen der AG war es völlig ungewiss, ob es je wieder eine deutsche jüdische Gemeinschaft geben könnte. Wer konnte als Jude schon im Land der Zuschauer und Mörder leben? Zudem nahmen antisemitische Schmierereien massiv zu. Der Mord am jüdischen Volk wurde in breiten Kreisen des deutschen Volkes und der Kirchen verdrängt. Alte Eliten aus der Zeit 1933 – 1945 saßen noch oder wieder in Schlüsselstellen der Justiz, der Politik, der Medien und der Universitäten. Die Mehrheitsgesellschaft fühlte sich zuerst als Opfer von »Hitler«, des »Krieges« oder der »Besatzer«. Man stürzte sich in den Wieder- und Neuaufbau, der für die meisten mit einem Wirtschaftswunder belohnt wurde und der auch die nicht selbst errungene Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als lohnend akzeptabel machte. In Jerusalem fand der Prozess gegen Eichmann statt, zu dem das AG-Mitglied Propst Grüber als Zeuge eingeladen war. Die wenigen in Deutschland lebenden Juden saßen auf »gepackten Koffern«.
Konstitutiv für diesen Neuanfang der AG ist die aktive Beteiligung von jüdischen Referenten in der Kirchentagsarbeit. Endlich musste nicht »über«, sondern mit Juden gesprochen werden. Jüdische wie christliche Fachleute sollten referieren und diskutieren. Diesen einhellig akzeptierten Vorschlag hatte der Hamburger Alttestamentler und das Vorstandsmitglied des DKR, Hans- Joachim Kraus, gemacht. Der Düsseldorfer Rabbiner, Robert Raphael Geis, Ernst Ludwig Ehrlich aus Basel (beide amtierten auch als Vorsitzende der AG) sowie Schalom Ben Chorin gehörten von jüdischer Seite dazu. Die Leiterin der Wiener Library in London, Eva Reichmann, fragte sehr direkt, warum die Christen die Juden immer nur als Christusmörder gesehen und verfolgt und nicht als Christusbringer akzeptiert hätten? Ihre Beiträge lösten lebhafte und kontroverse Diskussionen in der großen Messehalle am Funkturm aus.
Zum ersten Mal wurde 1961 durch die AG auf dem Kirchentag eine Resolution verabschiedet. Sie löste stürmische Diskussionen aus – wie die zuletzt 1999 in Stuttgart noch einmal erfolgte Ablehnung jeder Form von Judenmission. Dies war nötig geworden, da sich gerade im evangelikalen Feld eine seltsame Mischung aus Israelliebe und Judenmission breit machte.
Jüdische Bibelarbeiten, immer dialogisch und auf gleicher Augenhöhe angelegt, kamen erst 1973 – beginnend mit Edna Brocke und Gerhard Bauer – seit dem Düsseldorfer Kirchentag dazu. Sie waren und bleiben in ihrem Gang back to the roots, der jüdischen und der christlichen Bibel, auch ihrer neutestamentlichen Teile, immer ein Zentrum der Arbeit der AG bis heute. Hier wurde gelernt, wie unterschiedlich dieselben Texte überliefert wurden und gelesen werden. Die Hermeneutik, die Kunst des Verstehens, war auf christlicher Seite allzu oft durch unbewusste oder doktrinäre Vorgaben geprägt. Es sind vor allem zwei Schemata zu nennen, die die Zugänge zu biblischen Texten verbogen, wenn nicht verschlossen: Einmal ein zu simples Schema von Verheißung und Erfüllung, das übersieht, dass die jüdische Bibel wie die jüdische Geschichte »Erfüllungen« göttlicher Verheißungen selbstverständlich kennt und dass das Neue Testament ebenso selbstverständlich unerfüllte Verheißungen kennt.
So wenig das Alte Testament nur Vorläufer des Neuen ist, sondern seine eigene Stimme hat, so wenig trifft eine ähnlich schlichte Aufteilung von »Gesetz« und »Evangelium« auf AT und NT den biblischen Reichtum in allen Teilen der Heiligen Schriften. Dieses andere Schema denkt ebenso eindimensional, dass das Alte Testament »Gesetz« sei, Glaube also menschliche Leistung sei, demgegenüber das Neue Testament »gesetzesfreie« Botschaft der Gnade und Liebe sei – als ob die Erfahrung göttlicher Gnade und Liebe dem Volk Gottes von den Anfängen seiner Geschichte an fremd sei, als ob das Neue Testament nicht auch »Gesetz« (nach Paulus heilig, gerecht und gut, Röm 7,12) als Weisung zu einem Gott wohlgefälligen Leben enthalte. Neben der Erneuerung christologischer Aussagen ist die Bearbeitung dieser beiden traditionellen Voraussetzungen eines neuen Verstehens der Bibel wie ihrer beiden Fortsetzungsgeschichten im lebendigen Judentum und im lebendigen Christentum eine bis heute bearbeitete und zu bearbeitende Aufgabe.
Der Erfolg der dreitägigen Veranstaltungen auf dem Berliner Kirchentag übertraf alle Erwartungen. Das Programm der AG füllte nicht nur die größte Berliner Messehalle (5000 Sitzplätze), es wurden Übertragungen ins Freie und in Nachbarhallen nötig. Es war die am stärksten besuchte Veranstaltung des Kirchentages. Und sie war ebenso anspruchsvoll wie innovatorisch. Ein Erstmaliges, das seine Bedeutung auch dann nicht einbüßt, wenn man an das Meer von Blut und Tränen denkt, das wir zuvor durchschreiten mussten (R. R. Geis). Geis betonte sehr stark eine Gemeinsamkeit von Juden und Christen, die darin besteht, dass das Christentum gesellschaftlich nicht mehr mehrheitsfähig ist, wohl aber gesellschaftskritisch wirkt, wenn es sich endlich als das begreift, was es ist, eine Minorität, der mit dem macht- und mammonkritischen Gott Israels lebt und nicht irgendwelchen anderen Göttern und Mächten dient.
Was Geis aussprach, war über lange Zeit Konsens in der AG: Die ebenso kirchenkritische wie gesellschaftskritische Dimension aller Aktivitäten. Es bestand Einvernehmen darüber, dass Theologie und Kirchen zu den frühen und starken Lieferanten antijüdischer Verhaltensweisen gehörten und ebenso darüber, dass eine falsche Politik bzw. fehlende politisch-demokratische Wachheit zu den Bedingungen gehörten, die die Schoa und die unterbliebene Solidarität mit den diskriminierten und Verfolgten ermöglicht hatten.
Zum ersten Mal wurde 1961 durch die AG auf dem Kirchentag eine Resolution verabschiedet. Sie löste stürmische Diskussionen aus – wie die zuletzt 1999 in Stuttgart noch einmal erfolgte Ablehnung jeder Form von Judenmission. Dies war nötig geworden, da sich gerade im evangelikalen Feld eine seltsame Mischung aus Israelliebe und Judenmission breit machte. Sie speiste sich aus der alten Übung, das Judentum im Gegensatz zum Christentum – in aller »Liebe!« – als die anzusehen, die auf den Messias noch warten, während die Christen die Erfüllung der messianischen Hoffnung kennen.
Die Resolution von 1961 eröffnete für alle folgenden Kirchentage und ihre Veranstaltungen eine Partizipation der Teilnehmer, die erst später sich gelegentlich in Routine oder Formalismen erschöpfte. Die Resolution der christlichen Mitglieder der AG unterstreicht die unlösbare Verbundenheit mit dem jüdischen Volk, dessen Leugnung die »schuldhafte Verwicklung« der evangelischen Christen in Deutschland in den Massenmord mit verursachte. Daraus folgt heute (1961): (1) Es werden Eltern und Erzieher aufgefordert, gegenüber der jungen Generation das Schweigen zu brechen. (2) Es wird vor den unmenschlichen Möglichkeiten moderner Gesellschafts- und Staatsformen gewarnt und zu dem Risiko eigener politischer Verantwortung ermutigt, statt Befehlen zu gehorchen. Ehemalige Nationalsozialisten sollten aus führenden Ämtern ausscheiden. (3) Wir sollten alles tun, was den unter uns lebenden Juden das Leben sichert, ebenso alles, was dem Aufbau und dem Frieden des Staates Israel und seiner arabischen Nachbarn dient. Dazu gehören auch Entschädigungszahlungen an alle »Rasseverfolgten«. (4) Alles ist darin begründet, dass entgegen der falschen, in der Kirche jahrhundertelang verbreiteten Behauptung, Gott habe sein Volk verstoßen, wir uns neu auf das Apostelwort besinnen »Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat!« So werden die beiden Hauptthemen, die bleibende Erwählung Israels (behandelt durch Rabbiner R.R. Geis und den niederländischen, reformierten Theologen Th. Vriezen) sowie das schuldhafte Versagen der Christenheit (behandelt durch H.-J. Kraus und K. Kupisch) konkretisiert.
Der erste Punkt der Resolution zur Erziehung wurde immer wieder auf den folgenden Kirchentagen aufgegriffen und auf Schulbücher und Curricula der schulischen sowie auf die häusliche Erziehung bezogen. Seit dem Hamburger Kirchentag (1981) gab es das sog. »Lehrhaus für Christen«, das sich besonders an Erziehungsberufe aller Arten wandte. Hier wurde die Möglichkeit geboten, vorwiegend durch jüdische Referentinnen und Referenten vertiefte Kenntnis zu vermitteln, Erfahrungsaustausch und weiterführende Diskussionen zu betreiben. Hier steht mehr Zeit zur vertiefenden Diskussion zur Verfügung als in den großen Hallenveranstaltungen. Dies schien der AG auch deswegen notwendig zu sein, da immer wieder neue Besucher zu den Großveranstaltungen der AG kamen, die elementare Kenntnisse und Fragestellungen benötigten neben denen, die schon nicht mehr Anfänger im jüdisch-christlichen Gespräch waren. Die Leitung des Lehrhauses übernahm später der Weinheimer Schuldekan Albrecht Lohrbächer. Aber zurück zu den Anfängen:
Die Kritik während und nach dem ersten Kirchentag sprach, zum Teil wütend, zum Teil geschockt, vom Ausverkauf der Kirchengeschichte, ein anderer Vorwurf hieß Schwärmerei. Man sprach von einer Revolution der gesamten christlichen Theologie. Andere erinnerten daran, dass Juden und Christen doch nicht den gleichen Gott hätten. Es wurde deutlich, wie neu und wie notwendig eine umfassende Überprüfung nicht nur der Wissenschaftsgeschichte sowie der politischen und sozialen Geschichte Deutschlands war, obwohl diese erst in bescheidenen Anfängen ihrer Erforschung und Bearbeitung steckte. Die theologische Selbstkritik der kleinen AG war hier dem deutschen Aufklärungsprozess weit voraus.
Die Dokumentation des Berliner Kirchentages und seiner AG-Arbeit spitzte die neu zu lernende These in ihrem Buchtitel zu: Der ungekündigte Bund. Kritiker wie auch jene, die sich von einer unheilträchtigen Last dogmatischer Überlieferungen befreit fühlten, verloren einen Absolutheitsanspruch christlicher Theologie und Kirche, der nicht durch eine entsprechende Praxis gedeckt war und dem einzig »Absoluten«, dem biblischen Gott, etwas zu Gunsten der Kirchen stahl, was nur ihm zukommt. Die Berufung der Christenheit zu Gottes Gemeinde unter den Völkern war kein Monopolbesitz, nahm die Kirche ihre eigenen Glaubensgrundlage, das Alte wie das Neue Testament, ernst.
Der jüdische Weg von Gott zu Gott war als eigener Wert und Weg anerkannt. Es war klar, dass die Fortsetzung der Arbeit zu der Frage führen musste, wie ein damit kompatibles Kirchenverständnis aussehen könnte.
Die Dokumentation der Kirchentage von Dortmund und Köln (1963 und 1965) bündelt eine vorläufige Erkenntnis in dem Satz, dass Gottes Volk gespalten sei: Das gespaltene Gottesvolk. Weder Israel noch die Kirche sind am Ende ihres Weges angekommen. Weder das eine noch die andere ist das erwartete Reich Gottes, die messianische Zeit. Beide stehen im Dienst desselben Gottes. Nach dem Ende der Enterbungstheorien ging es um den sachgemäßen Ausdruck des Tatbestandes, dass Gottes Wahrheit »auf zweier Zeugen Mund« (5.Mose 17,6; Joh 8,17) in der Welt ruht. Die Folgefrage hieß, ob die (neutestamentliche) Übertragung des Namens »Volk Gottes« auf die christliche Gemeinde noch eine brauchbare Redeweise ist, wenn die (legitime) Aneignung dieser Würde mit einer langen Geschichte der Enteignung des ersten und bleibenden Gottesvolkes verbunden ist? Wäre es nicht klarer, von Gottes Volk Israel einerseits und andererseits von Gottes Kirche zu sprechen, um die beiden Größen zu benennen, die in seinem Dienst stehen? Ebenso sollte vermieden werden, Begriffe zu benutzen, die Juden und Christen unterschiedlich verstehen. »Volk« ist auch eine ethnische Größe, in die man geboren oder durch Eintritt aufgenommen wird. Das Christenvolk konstituiert sich durch Glauben und Taufe von Einzelnen.
3. Der lange Weg
Die Kirchentage 1967 (Hannover) und 1969 (Stuttgart) standen sehr stark im Zeichen der Friedensfrage und zwar im Blick auf den Nahen Osten wie im Blick auf eine Weltverantwortung von Juden und Christen für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt.
Auf dem Ökumenischen Pfingsttreffen 1971, einem Vorläufer des Berliner Ökumenischen Kirchentages 2003, wurde die gemeinsame Verantwortung durch eine Erklärung unterstrichen, die von Mitgliedern der AG, N.P. Levinson, W.P. Eckert, F. von Hammerstein und M. Stöhr, entworfen und unterzeichnet war, einem jüdischen, einem römisch-katholischen und zwei protestantischen Mitstreitern. Sie gab u.a. einen Anstoß, einen entsprechenden Arbeitskreis für die Katholikentage zu gründen.
Die Aufarbeitung der theologischen Verständnisse war ein Langzeitprogramm. Zu Verschiedenes bedeuteten z.B. die in den Gottesdiensten gebrauchten identischen Worte, zu unterschiedlich wurden Prophetenworte gelesen, zu wenig kannte die christliche Seite die mündliche Offenbarung, wie sie in Talmud und Midrasch vorliegen. Verschiedenes Gewicht hatten die Gebote und »Lehraussagen«.
Näher liegend war es, praktische Zusammenarbeit anzustreben. Das zeigte sich z.B. auf dem Kirchentag in Hannover (1967) und Stuttgart (1969), als die Friedensthematik sich sehr stark in den Vordergrund schob. Das war zum einen durch den Nahostkonflikt bedingt, der ein verschärftes Fragen der studentischen Generation nach dem, was ihre Eltern denn im Krieg, der den mörderischen Rahmen und die Bedingungen geschaffen hatte, in der lange vorbereiteten »Endlösung« die Vernichtung des jüdischen Volkes durchzuführen. Zum anderen war der ungelöste Nahostkonflikt, genauer die noch immer fehlende Anerkennung des Lebensrechtes des jüdischen Staates durch seine arabischen Nachbarn der Anlass, sich dieser Frage auch im Programm der AG zu stellen. Hinzu kam, dass durch eine wachsende Gruppe ein Blickwechsel vorgenommen wurde, der die »Juden von heute« in den Palästinensern oder in den »Gastarbeitern« sah. Eine verhängnisvolle Sichtweise, bei der die konkreten Menschen und Situationen zu Metaphern für die Zugehörigkeit zur Seite der »Guten« oder der »Bösen« in einer dualistischen Weltsicht wurden.
Die Problematik solcher Nahostpodien begleitete die AG bis heute, nachdem 1969 zum ersten Mal ein arabischer Referent auf ein Podium der AG gebeten wurde. Der Debatte auszuweichen, wie es immer wieder vorgeschlagen und diskutiert wurde, hätte die von der AG seit ihren Anfängen vertretene Zusammengehörigkeit (nicht Vermischung!) theologischer und politischer Probleme sowie eine Verantwortung für die Folgen des deutschen Judenmordes geleugnet.
Die Problematik solcher Nahostpodien begleitete die AG bis heute, nachdem 1969 zum ersten Mal ein arabischer Referent auf ein Podium der AG gebeten wurde. Der Debatte auszuweichen, wie es immer wieder vorgeschlagen und diskutiert wurde, hätte die von der AG seit ihren Anfängen vertretene Zusammengehörigkeit (nicht Vermischung!) theologischer und politischer Probleme sowie eine Verantwortung für die Folgen des deutschen Judenmordes geleugnet. Die Wahrnehmung politischer Verantwortung, z.B. im Eintreten der AG für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel, die endlich 1965 geschah oder das Eintreten gegen eine Verjährung von NS-Verbrechen, die im Auftrag der AG Dietrich Goldschmidt und Jürgen Henkys in einem viel beachteten Band dokumentierten,7 war aus einer theologisch-ethischen Motivation heraus unbestritten.
Zum Streit kam es im zweiten Golfkrieg 1991, als die Solidarität mit Israel in Frage gestellt wurde und als der Schwur vieler Überlebender der Vernichtungslager und des Krieges »Nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg!« auseinander fiel. Gab und gibt es nicht Situationen, in denen ein Verteidigungskrieg und Verteidigungswaffen bejaht werden müssen?8 Wie sieht eine unaufgebbare Solidarität mit Israel aus, wenn Israel nicht nur in der Rolle eines Opfers von Aggressionen und Terror gesehen wird, sondern das legitime Recht von Selbstverteidigung wahrnimmt? Welche seiner Regierungen überschreitet wann diese von allen anerkannte Legitimität? Was bedeutet es für die Glaubwürdigkeit und Aufgabenstellung der christlichen AG-Mitglieder, dass deutsche Lieferungen das Vernichtungsmaterial (Gas, Raketentechnik) gegen Israel im Irak oder auch in Libyen in Stellung gebracht hatten? Eine kritische Situation, mit unterschiedlichen Analysen und Antworten, lähmte die AG.
Das 1971 wurde in Augsburg – der Stadt des Augsburger Religionsfriedens von 1555 – so formuliert: Christliches Zeugnis findet Ausdruck in dem gemeinsamen praktischen Eintreten von Juden und Christen für mehr Gerechtigkeit; mehr Menschenwürde im Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Judenmission widerspricht diesem biblischen Auftrag. Die konkrete Konsequenz einer ökumenischen Zusammenarbeit zwischen Juden und Christen verwirklicht sich auch in kritischer Solidarität mit dem Staat Israel und seinen Menschen sowie dem politischen Engagement für den Frieden im Nahen Osten.
Die Schwierigkeiten einer praktischen Kooperation, die sich in asymmetrischen Lebensverhältnissen auf ethische Gemeinsamkeiten bezogen, lagen auf der Hand. Winzige jüdische Gemeinden, die nicht wussten, ob sie in Deutschland eine Zukunft hatten. Stattliche Volkskirchen, noch im Bewusstsein ihrer (vermeintlichen) Stärke und theologischen correctness. Von ihrer Seite wurde der Begriff »Zeugnis« auch gegenüber dem Judentum immer wieder eingefordert. Geis unterstrich, dass Zeugnis für uns eine höchst blutige Angelegenheit war und ist. Zeugnisablegen heißt für uns nämlich für Gott sterben … Einmal hatte die Kirche die Chance des Christusbekenntnisses gegenüber uns Juden: Im Dritten Reich. Diese Chance ist nicht wahrgenommen worden!
Geis spielt an auf die Bedeutung und geschichtliche Erfahrung des kiddusch haSchem, die Heiligung des Namen Gottes im Martyrium, etwas, worum die Christen im Vaterunser beten, aber in ihrer Spiritualisierung und Verinnerlichung des Glaubens dessen leibhaftige und praktische Gestaltwerdung allzu häufig übersehen.
Die AG hatte zu lernen, dass sie einer Illusion aufgesessen war, als sie meinte, dass nach einigen Kirchentagen die neuen Erkenntnissen und Bekenntnisse sich in Schule, Hörsaal und Kirche herumgesprochen hätten. Die Diskussionen innerhalb der AG-Veranstaltungen auf dem Kirchentag und außerhalb zeigten in subtilen und in rüden Einwürfen (jedem jüdischen und christlichen Vortrag folgten Diskussionen), wie zäh theologische und säkulare Herabwürdigungen der Juden lebten und wie verschwistert sie oft auftreten konnten. Den teilnehmenden Juden wurden sie oft ungehemmt vorgetragen. Das Gleiche geschah mit Fragen wie »Herr Rabbiner, habe ich Sie recht verstanden, Sie haben in Ihrer Bibel auch die Psalmen?« Mit dieser typischen, wenn auch nicht zu verallgemeinernden Frage wird auf den selbstverständlichen Gebrauch der Hebräischen Bibel hingewiesen, der natürlich legitim ist. Aber sehr häufig offenbart er eine Israelvergessenheit, in der die Psalmen (oft nur in einem Einband mit dem Neuen Testament oder gottesdienstlich mit der trinitarischen Formel) christlich vereinnahmt werden. Hätten ich und viele andere gewusst, sagte ein alter Mann, der sein Leben lang neben der erst lebendigen, dann 1938 niedergebrannten Synagoge wohnte, dass die Juden auch die Bibel im Gottesdienst lesen und denselben Segen wie wir sprechen, dann wäre das alles sicher nicht passiert. Unkenntnis, Halbwissen und Vorurteile zu überwinden, erwies sich als eine Herkulesaufgabe. Aber die Arbeit in der AG zeitigte Folgen und Früchte.
1975 hielt zum ersten Mal auf einem Kirchentag ein Rabbiner, Nathan Peter Levinson, die Predigt in einem christlichen Eröffnungsgottesdienst des Kirchentages.
Ihm sollten weitere Rabbiner folgen und zugleich eine leidenschaftliche Debatte darüber, ob, und wenn ja, wie gemeinsame christlich-jüdische Gottesdienste zu verantworten seien.
Man kann die Arbeit der AG als die Arbeit in einem Laboratorium kennzeichnen, das in seiner Studienarbeit, in seinem öffentlichen Auftreten und in seiner Ausstrahlung in Schulen, Kirchen und Universitäten wichtige Anstöße in die deutsche Gesellschaft und in die Ökumene gab.
Die Meinungen dazu sind bis zum heutigen Tag in der AG geteilt, und zwar innerhalb der christlichen wie innerhalb der jüdischen Mitglieder. Zu wenig schien den einen geklärt zu sein, ob die Worte, die im Gottesdienst gebraucht werden, ob das Gottesdienstverständnis geteilt wird? Es ist doch nicht einmal zwischen Christen einheitlich
Andere, mit einem weniger sakralen Verständnis der Gottesdienste argumentierten (wie im innerchristlichen Streit um gemeinsames Abendmahl), dass »die Sache« des Gottesdienstes größer sei als unsere verschiedenen Verständnisse und also dem Ruf Gottes auch in Unsicherheit zu folgen sei. Bis heute ist auch diese Debatte nicht abgeschlossen.
Dasselbe gilt von der Auseinandersetzung um die Frage, ob die AG es nicht ablehnen müsse, sich stärker im weiten Themenfeld des Kirchentages zu engagieren? Sind wir nicht erst ganz an den Anfängen der Erneuerung jüdisch-christlicher Beziehungen? Würden wir uns nicht übernehmen? Andere verwiesen auf eine gemeinsame Grundüberzeugung der AG: Das Thema »Juden und Christen« ist kein Spezialthema für Spezialisten. Es gehe nicht um Professorentheologie für Theologieprofessoren, so Dietrich Goldschmidt. Gemeinsame Schritte könnten am besten in gemeinsamer Praxis geprobt werden. Aber reichen unsere Kräfte aus? Inzwischen hat sich die Grundsatzdebatte eher pragmatisch weiterentwickelt. Viele Mitglieder der AG sind in vielen Bereichen des Kirchentages tätig, z.B. in dem wichtigen Bereich der Bibelarbeiten, aber nicht nur dort. Es sind beispielsweise zu nennen Edna Brocke, Micha Brumlik, Marlene und Frank Crüsemann, Albert Friedlander s. A., Günther B. Ginzel, Bertold Klappert, Rolf Rendtorff oder Klaus Wengst.
Wenn ich auch keine vollständige Chronik der AG schreiben kann und will, darf ich aber zwei Dinge nicht vergessen zu sagen: Einmal ein Hinweis auf den Nürnberger Kirchentag 1979. Er rief die Erinnerung an die »Reichsparteitage«, an die Nürnberger Gesetze, an jenes so schändliche Gutachten der Erlanger theologischen Fakultät wach, das – im Gegensatz zum Marburger Gutachten von Rudolf Bultmanns und Hans von Sodens theologischer Fakultät – die Einführung des sog. Arierparagrafen in die Kirche befürwortete. Glauben nach Auschwitz war das dominierende Thema. Albert Friedlander und F.-W. Marquardt sprachen dazu.
Friedlander nahm das Bild von der Taube auf, die Noah aussandte, um zu erkunden, ob die Erde wieder bewohnbar war nach der von Menschen verursachten Katastrophe. Aber Noahs Schiff reiste weiter. Die Furcht ist Passagier geworden – aber auch die Hoffnung. Die Hoffnung und der Glaube sind nicht bequem, aber beide bestehen. Marquardt schloss seinen Vortrag mit den Worten: Das Wort des Glaubens in unserer Zeit kann und will nicht mehr pompös-deklamatorisch sein, es ist das ‚vielleicht‘ eines zaghaften Hoffens. Doch auch das Wort von Gottes erbarmender Liebe heißt: vielleicht … Vielleicht? … Vielleicht. In der Mitte der Kirchentagsstrecke unserer AG war wie so oft die Erinnerung an den Anstoß ausgesprochen, der am Anfang einer Bemühung um die Erneuerung der Beziehungen zwischen Kirchen und Israel stand: Auschwitz. Das Gedenken zog an diesem Abend auch den Sprecher der Roma und Sinti, Romani Rose auf das Podium von Friedlander und Marquardt. Er sprach für den Völkermord an seinem Volk, das wie das jüdische Volk total ausgelöscht werden sollte. Es hatte bis dato weder eine Anerkennung der Schuld noch seines Leidens noch den Versuch einer »Entschädigung« erfahren. Aus dieser ungeplanten Begegnung wurde eine längere Zusammenarbeit der AG mit dem Zentralrat der Roma und Sinti.
Der grundlegenden Frage, welche Vorurteilsmuster sich mit dem Antisemitismus verbünden, ging die AG nicht nur im Blick auf Roma und Sinti nach. In einer intensiven Arbeit auf dem Nürnberger Kirchentag wurde der überall, besonders aber in der Apartheidpolitik Südafrikas, aktive Rassismus thematisiert. Unter dem Titel »Rassismus: Von den Nürnberger Gesetzen bis zur Apartheid« kam nicht nur die Bündnisfähigkeit des Antisemitismus mit jedem Rassismus zur Sprache, sondern auch die Übernahme nazistischer Rassegesetze durch die weiße Minderheitsregierung und die Mitwirkung alter Nazis an und in den südafrikanischen Apartheidstrukturen. Zu dieser Aufklärungsaufgabe gehört auch die Fragestellung, wie mit der Tatsache umzugehen sei, dass deutsche Raketenbauer und Waffenhändler in Ägypten, im Irak, in Libyen und in Syrien an der Entwicklung und am Verkauf von deutschen Waffensystemen gegen den Staat Israel (bis hin zu Giftgaskomponenten) beteiligt waren. Bei diesen Themen – wie auch bei der Behandlung von Fremdenfeindschaft oder Demokratieverachtung – wurde nie die Singularität der Schoa in Frage gestellt, wohl aber die Frage nach den Vorbedingungen, den Bündnispartnern judenfeindlicher Haltungen und ihr Weiterleben nach 1945 behandelt. Das gilt auch von der Verknüpfung nationa- ler und christlicher Argumente gegen die Juden durch den entlassenen Hofprediger, Sozialreformer und Gründer der Berliner Stadtmission Adolf Stoecker. Eberhard Bethge analysierte 1977 auf dem Kirchentag in Berlin, dem Ort von dem Stoeckers Wirkung weit ins Bürgertum ausstrahlte.
Man kann die Arbeit der AG als die Arbeit in einem Laboratorium kennzeichnen, das in seiner Studienarbeit, in seinem öffentlichen Auftreten und in seiner Ausstrahlung in Schulen, Kirchen und Universitäten wichtige Anstöße in die deutsche Gesellschaft und in die Ökumene gab.
4. Folgen und Früchte
James Parkes, der als erster Historiker und Theologe den christlichen Antijudaismus und den säkularen Antisemitismus erforschte – gerade auch in ihren Zusammenhängen mit antidemokratischen Einstellungen – berichtet von einem Sponsor seiner Forschung, der ihn fragte, wie lange er zur Überwindung der judenfeindlichen Einstellungen benötige. Parkes antwortete ca. 300 Jahre. Hätte er 50 Jahre genannt, hätte der Sponsor ihm nichts gegeben.
Aus der Einsicht, einen langen Weg noch vor sich zu haben, entstand in der AG der Vorschlag, die EKD möge eine Studienkommission einsetzen, die in einer Denkschrift grundlegend die Beziehungen zwischen Juden und Christen bearbeiten sollte. Modell war die politisch und kirchlich ebenso umstrittene wie wirkungsvolle Ostdenkschrift von 1965. 1967 folgte die EKD diesem Vorschlag und setzte eine solche Kommission ein, in die sehr viele AG-Mitglieder berufen wurden (13 von 23). 1975 legte diese ihre Studie Juden und Christen vor, der 1991 und 2000 die Studien II und III folgten.
Die letzte konnte auf die inzwischen erfolgten offiziellen Erklärungen vieler protestantischer Landeskirchen hinweisen. Deren Konsens für kirchliche Lehre und Verkündigung fasst die Studie von 2000 grob so zusammen: Die Entfremdung zum Judentum überwinden, den Antisemitismus bekämpfen, die christliche Mitverantwortung am Holocaust nicht leugnen, die unlösbare Verbindung des christlichen Glaubens mit dem Judentum, die bleibende Erwählung Israels, die Bedeutung des Staates Israels. Noch längst nicht sind diese Einsichten in alle Felder theologischer und kirchlicher Arbeit durchgedrungen. In einer kritischen Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf, dessen Sekretär der Abteilung Kirche und Jüdisches Volk das AG- Mitglied Franz von Hammerstein eine Zeit lang war und in dessen Studienkommission verschiedene AG-Mitglieder arbeiteten, heißt der weltweit und ökumenisch erzielte Konsens (in der Formulierung von 1988): Der Bund Gottes mit Israel besteht weiter; Antisemitismus ist Sünde; Die lebendige Tradition des Judentums ist ein Geschenk Gottes; Jeglicher Proselytismus ist unvereinbar mit dem christlichen Glauben; Juden und Christen haben die gemeinsame Aufgabe, sich gemeinsam für Gerechtigkeit, Versöhnung und Bewahrung der Schöpfung einzusetzen (so Hans Ucko, ÖRK). Eine Stellungnahme zum Staat Israel fehlt hier. Dessen Anerkennung im Geburtsjahr des ÖRK und des Staates war nie zweifelhaft. Eine theologische Aussage über die essenzielle Fragestellung »Land-Volk-Staat Israel«, die über die Forderung nach Frieden und Gerechtigkeit hinausging, war angesichts der Mehrheit der Zweidrittelwelt im ÖRK nicht möglich. Wohl aber wurde und wird das Lebensrecht Israels und eines Staates Palästina – gemäß der UNO-Resolution von 1947 – immer wieder mit Nachdruck vertreten.
Die erste Studie ging bewusst von den Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Christen aus. Es war die Gegenposition zu dem traditionellen Muster der Ausgrenzung und des angeblichen Bruchs Gottes mit Israel durch das Erscheinen Jesu von Nazaret. Die Trennung der Wege und die bleibenden Unterschiede wurden ebenso benannt wie der essenzielle Zusammenhang von Volk, Bund und Land. Die Verantwortung für das Lebensrecht Israels und für einen Frieden in Nahost gehörten ebenso dazu, und das in einer Zeit, in der der Vatikan den Staat Israel nicht anerkannt hatte, die Anerkennung geschah erst 1993. Im ökumenischen Kontext darf nicht vergessen werden, dass der Vatikan in seiner Erklärung von Nostra Aetate des Jahres 1965 einen epochemachenden Schritt zur Erneuerung der Beziehungen zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und dem Jüdischen Volk getan hatte, der weiter über Rom hinaus ausstrahlte.
Der Lutherische Weltbund rief 1964 nach Lögumkloster in Dänemark eine Studientagung ein, wo die bleibende Erwählung Israels zwar vertreten wird, aber zugleich die Hoffnung ausgesprochen wird, dass ganz Israel (nach Röm 11,26) in Jesus von Nazareth seinen Messias anerkennt. Dann erst wird das Geheimnis der Treue Gottes gegenüber seinem Volk klar. Es berührt seltsam, dass im zweiten Teil des Satzes Gottes Geheimnis beschworen wird, das im ersten Teil aber schon in einer christlichen Sicht gelüftet erscheint. Der ÖRK veröffentlichte 1967 in Bristol eine 1967 begonnene Studie, deren Kernthese die bleibende Erwählung Israels ist, womit der These abgesagt wird, die Kirche habe Israel im enterbenden Sinne beerbt und abgelöst.
In Zusammenarbeit der AG mit dem DKR und der Evangelischen Akademie Arnoldshain entstanden Studientagungen, die die sich ausweitenden Arbeitsfelder vertiefend beackerten. Ihre Ergebnisse wurden zum Teil in der Reihe des Chr. Kaiser- Verlages Abhandlungen zum jüdisch-christlichen Dialog (Hg von H. Gollwitzer, zu dem später E. Bethge, U. Berger, A. Friedlander, M. Stöhr kamen).9 Es waren Eberhard Bethge, Freund und Biograf Dietrich Bonhoeffers, und Nathan Peter Levinson, die die Fragestellungen und Ergebnisse der US-amerikanischen Holocaust-Forschung in die Arbeit der AG und in die erste deutsche Holocaust-Konferenz 1975 in Hamburg einspielten. Diese Forschung war interdisziplinär und fragte besonders nach der Rolle der Intellektuellen aller Disziplinen in der Vorbereitung und Durchführung des Holocaust. Wäre ohne ihre ethikfreie Komplizenschaft und ohne eine verantwortungslose Machtübergabe der Bürgerinnen und Bürger an einen kontrollfreien Staat die Gewalt der brutalen Mörder möglich gewesen? Der US- amerikanische Kirchenhistoriker Franklin Littell gehört zu den frühen Promotoren, auch in der AG, einer zu erneuernden Beziehung zwischen Juden und Christen. Er war mit seinen Veröffentlichungen und deutsch-amerikanischen Kontakten ein verdienstvoller transatlantischer Brückenbauer. Aus den Niederlanden kamen ebenso intensive theologische Impulse, die der Neuorientierung halfen.
5. Bleibende Themenfelder und Aufgaben
- Immer wieder – etwa 40 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz – wurde thematisiert, welche Fragen noch immer zu stellen, welche Ant- worten ungenügend waren. Wie ist zu vermeiden, dass aus »Auschwitz« ein bloßes Lehrstück wird, das pädagogisch oder politisch »verwertbar« wird? Bei einer dieser Diskussionen erklärte ein befragter Politiker, dass diese ihm wichtige Erinnerung keine Auswirkung auf seine alltägliche politische Arbeit habe. Wie aber sieht dagegen die bleibende Verantwortung und Haftung der nachwachsenden Generation aus, die am Geschehen bis 1945 schuldlos ist? Wie wird die Stimme der Opfer und ihrer Nachkommen, auch die Theodizeefrage »Wie kann Gott den Tod von Millionen Unschuldigen zulassen?«, ernsthaft gehört? Wie wird vermieden, dass die »Täterseite« sich zu schnell dieser Frage zuwendet, statt zu fragen, welche Einstellungen und Haltungen dergleichen ermöglichten und in Zukunft verhindern?
- Wie ist eine Entfaltung des christlichen Glaubens möglich, der nach seiner eigenen Selbstverstümmelung durch Bilder von Gott (»alttestamentarischer Rachegott«) sowie von der Mutter- und Schwesterreligion des jüdischen Volkes (»Gottesmörder«, »Gesetzlichkeit«, »Partikularität«) sich selbst entworfener antijüdischer Bilder bediente, die den Boden zu einem feindlichen Umgang mit diesem Volk und seiner vielgestaltigen Lebenswirklichkeit vorbereiteten? Wie ist ein feindbildloser Glaube der Christusnachfolge möglich?
- Wie beschreiben und verstehen Kirchen und Theologien die Beziehung zu Israel, dem jüdischen Volk, dessen Bund mit Gott ungekündigt ist? Gibt es zwei Gottesvölker? Ist Gottes Volk »gespalten« bis zur Vollendung der Welt? Ist die Christenheit in diesen Gottesbund hineingenommen?
- Tod und Auferweckung Jesu sind nach christlichem Glauben der Anfang der messianischen Zeit, der neuen Schöpfung durch Gott. Jesus, der Christus, ist der »Erstgeborene einer neuen Schöpfung« (1 Kor 15). Dazu gehört die Einladung an die Völker der Welt, diesen Einen Gott anzubeten, seinen Willen bekannt zu machen und ihm nachzufolgen und so sein Reich zu bauen, d.h. die Welt zum Guten hin zu verbessern. Diese Gaben und Aufgaben sind zusammengefasst im Vaterunser.
- Wie benützen Kirchen und Theologien die Kategorien »Verheißung und Erfüllung« sowie »Evangelium und Gesetz« und erkennen dabei an, dass es nicht möglich ist, sie so auf Altes und Neues Testament zu verteilen, dass »Gesetz« und »Verheißung« zum Kennzeichen eines überholten Judentums, und »Erfüllung« und »Evangelium« werden? Erfüllende, frohe Botschaft und Leben orientierende Gesetze gibt es in beiden Teilen der christlichen Bibel.
- Juden und Christen lesen dieselbe Bibel, die Hebräische Bibel, mit ihren beiden unterschiedlichen Verstehens- und Wirkungsgeschichten im lebendigen Judentum und im lebendigen Christentum. Diese haben ihre neu-weiterführenden Quellen in der rabbinischen Literatur und im Neuen Testament. Weder sichert das eine noch das andere die normative Position, man selbst verstehe allein die gemeinsame Grundlage »richtig« noch sind päpstliches Lehramt, protestantisches Materialprinzip (z.B. »Rechtfertigungslehre«, »Theologia Crucis«) oder fundamentalistische Verbalinspiration mögliche Glaubenssicherungen.
- Theologie wie Nachfolge geschehen im ständigen Gespräch mit den Stimmen der Überlieferung und den Herausforderungen der jeweiligen Situation und Zeit. Dabei ist es geboten, sich konkret für eine »absolut richtige« Position zu entscheiden. Eine alles vergleichgültigende Unentschiedenheit widerspricht den Herausforderungen der jeweiligen Heiligen Schriften wie der jeweiligen Zeit. So wird Respekt vor dem Anderssein der anderen gelernt und eine Toleranz verlernt, die den anderen bloß duldet.
- Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass »Gottes Wahrheit auf zweier Zeugen Mund« ruht, also jeder religiöse Triumphalismus und Absolutheitsanspruch angesichts der Indienstnahme Israels und der Kirchen durch den einzig »Absoluten« obsolet ist?
- Es ist unbestritten, dass es für die deutsche Gesellschaft eine besondere Beziehung zum jüdischen Staat Israel gibt, die eine Verantwortung für dessen Leben und völkerrechtliche Absicherung beinhaltet. Sie steht in einer nicht wegzuschiebenden Verantwortung auch für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten sowie für das Lebensrecht des palästinensischen Volkes.
- Wie gehen wir mit der unverzichtbaren Grundlage der jüdisch-christlichen Arbeit um, dass es eine singuläre Beziehung zwischen Judentum und Christentum gibt, die – auf Grund gemeinsamer Heiliger Schriften – sonst zu keiner Religion gibt?
Fußnoten
- Ulrike Berger, langjähriges Mitglied und Protokollantin der AG, in ihrer wissenschaftlichen Hausarbeit zum Zweiten Theologischen Examen, Berlin 1980
- Folgende Darstellungen berichten über die Geschichte der AG und verweisen ausführlich auf weiterführende Literatur: Dietrich Goldschmidt, Zwanzig Jahre Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen, in: Deutscher Ev. Kirchentag Hamburg 1981, Stuttgart/Berlin 1981; Martin Stöhr, Ökumene, Christlich-Jüdische Gesellschaften, Akademien und Kirchentag. In: Evang. Theologie 4-2001, S.290-301; Gabriele Kammerer, In die Haare, in die Arme. 40 Jahre Arbeitsgemeinschaft »Juden und Christen« beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Gütersloh 2001. Den Autorinnen Berger und Kammerer folge ich mit großer Dankbarkeit in wesentlichen Teilen, ohne den Beleg jeweils festzuhalten
- Der Ausdruck Israel bezeichnet immer das jüdische Volk (Am Jisrael), das im Lande Israel (Erez Jisrael) und in der Diaspora (Galut) lebt. Ist vom Staat Israel die Rede, ist das Wort Staat (Medinat Jisrael) hinzugefügt
- Die Arbeit der AG ist in folgenden Bänden dokumentiert: D. Goldschmidt/H.-J. Kraus, Der ungekündigte Bund. Neue Begegnung von Juden und christlicher Gemeinde. Stuttgart 1963; Helmut Gollwitzer/ Eleonore Sterling, Das gespaltene Gottesvolk, Stuttgart 1966; Robert Raphael Geis u.a. (Hg.), Juden und Christen im Dienst für den Frieden, Stuttgart 1967; Robert Raphael Geis u.a. (Hg.), Gerechtigkeit in Nahost, Stuttgart 1969; P. von der Osten-Sacken/Martin Stöhr (Hg.), Wegweisung – Jüdisch- christliche Bibelarbeiten und Vorträge (Berliner DEKT 1977), VIKJ Bd. 8, Berlin 1978; Diess., Glaube und Hoffnung nach Auschwitz (Nürnberger Kirchentag 1979) VIKJ Bd. 12, Berlin 1980; Dazu kommen die Dokumentarbände des DEKT
- Freiburger Rundbrief 1978, S.10
- Einen Überblick über die Neuansätze nach 1945 gibt Rolf Rendtorff, Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Die evangelische Kirche und das Judentum seit 1945. Ein Kommentar. München 1988. Die Dokumente (weltweit und interkonfessionell) liegen vor in zwei umfangreichen Bänden: R. Rendtorff / H.H. Henrix (Hg.), Kirche und Judentum. Dokumente von 1945-1985, Paderborn / München 1988; H. H. Henrix / W. Kraus (Hg.), Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1986-2000. Paderborn / Gütersloh; Ulrich Schwemer (Christen und Juden. Dokumente einer Annäherung. Gütersloh 1991) hat eine kommentierte knappe Dokumentensammlung herausgegeben
- Jürgen Henkys, Die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Geschichte und Gericht, Stuttgart 1964
- Ein Einblick in die Debatte mit Beiträgen von Edna Brocke und Jürgen Moltmann gibt Kirche und Israel, Heft 6,1 und 6,2. 1991
- Hier seien als Beispiele genannt: F.-W. Marquardt, Die Entdeckung des Judentums für die christliche Theologie, 1967; W.P. Eckert/N.P. Levinson/M. Stöhr (Hg.), Antijudaismus im Neuen Testament?, 1967; Dies., Jüdisches Volk – Gelobtes Land, 1970; R. Ruether, Nächstenliebe und Brudermord, 1978; Charlotte Klein, Theologie und Antijudaismus, 1978; M. Stöhr (Hg.), Zionismus – Beiträge zur Diskussion. 1980; M. Stöhr (Hg.), Jüdische Existenz und die Erneuerung der christlichen Theologie, 1981; P. von der Osten-Sacken, Grundzüge einer Theologie im christlich-jüdischen Gespräch, 1982