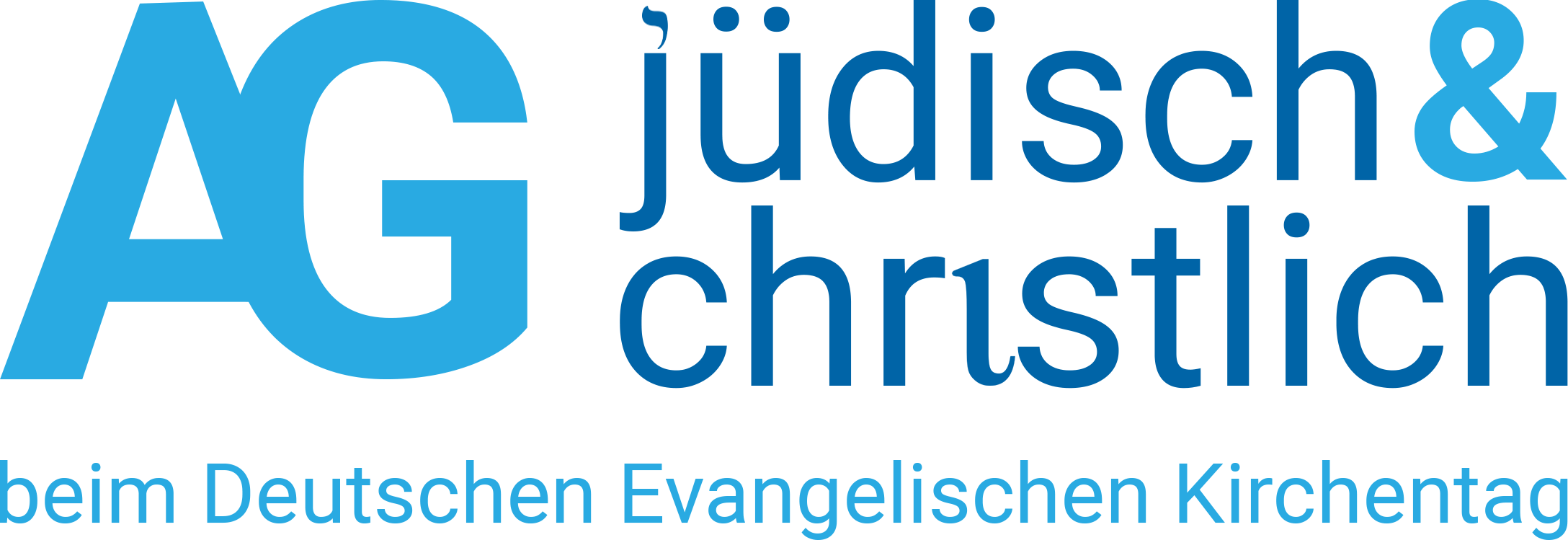Gegen Antisemitismus:
Praktische Solidarität statt abstrakte Vorwürfe
Beitrag von Milena Hasselmann und Maria Coors auf evangelisch.de
Maria Coors und Milena Hasselmann
Das politische Klima in Deutschland ist eine Herausforderung für das christlich-jüdische Gespräch. Die Theologin Milena Hasselmann und die Historikerin Maria Coors fordern, dass Kirche und Gesellschaft darauf reagieren sollten, wenn jüdische Menschen stärkeren Schutz einfordern. Ein Gastkommentar.
Ein Beitrag des Pfarrers Rainer Stuhlmann in der Arbeitshilfe der Evangelischen Kirche im Rheinland zum 70. Jubiläum der Staatsgründung Israels führte Ende April 2018 zu einem Eklat: Stuhlmanns verkürzte und missverständliche Formulierungen zur Bedeutung der Staatsgründung Israels für die arabischen Bewohnerinnen und Bewohner sowie seine Bewertung der Siedlerbewegung wurden von Seiten des Landesverbands jüdischer Gemeinden von Nordrhein als antisemitisch und antizionistisch wahrgenommen. Da die Kirchenleitung sich nicht von dem Text distanzierte, sagte der Landesverband eine gemeinsam geplante Israelreise ab.
In einem Beitrag der ZEIT-Beilage „Christ & Welt“ (19/2018) wird der evangelischen Kirche pauschal ein Antisemitismusproblem attestiert. So richtig die Frage nach strukturellem Antisemitismus in Theologie und Kirche ist, so wenig nimmt sie die konkrete Situation und Ereignisse an dieser Stelle ernst und verstellt damit den Blick darauf, dass der Fall Stuhlmann nicht Zeichen einer ausschließlich kirchlich-theologischen Problematik ist, sondern vielmehr Symptom einer aktuellen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die praktische und nicht nur abstrakte Konsequenzen nach sich ziehen muss.
Wer den Text von Stuhlmann aufmerksam liest, findet kein polemisches Positionspapier: Er betont die enge Verbundenheit von Judentum und Christentum, die vor allem aus christlicher Sicht existentiell ist. Er zitiert den historischen Synodalbeschluss von 1980, in dem die Rheinische Landeskirche die „Errichtung des Staates Israel als eine Zeichen der bleibenden Treue Gottes zu seinem Volk“ sieht und die Staatsgründung und damit die Existenz des Staates Israel unmissverständlich bejaht und begrüßt. Daneben gibt es jedoch Sätze, die leicht in ein antisemitisches Argumentationsschema fallen und die die Entrüstung und Bestürzung des Landesverbandes erklären. Dazu gehören Aussagen wie jene, dass die Staatsgründung Israels für die arabische Seite „Vertreibung, Zerstörung, Zwang und Unrecht“ bedeutete oder dass Israel in den vergangenen Jahren „brutal seine Interessen gegen Palästina [durchgesetzt]“ habe. Eine Distanzierung der Landeskirche wäre durchaus wünschenswert gewesen. Der Blick auf den weiteren Kontext macht jedoch deutlich, dass ein pauschaler Antisemitismusvorwurf zu kurz greift. Weder der lange in Israel tätige Pfarrer noch die langjährig im Dialog engagierte Landeskirche haben sich Antisemitismus in welcher Form auch immer auf die Fahnen geschrieben. Woher kommt also der Eklat?
Antisemitische Einstellungen in der Kirche
Es zeigt sich hier, dass eine Trennung von Kirche und Gesellschaft weder sinnvoll noch sachgerecht ist. Die deutsche Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren verändert. Politikerinnen und Politiker der AFD, wie etwa der baden-württembergische Landesabgeordnete Wolfgang Gedeon, bringen ohne nennenswerte Konsequenz Holocaustverharmlosungen und antisemische Feindbilder auf die politische Bühne. Die Zahl angezeigter antisemitischer Straftaten steigt und dabei handelt es sich auch um direkte physische Gewalt. Jüdinnen und Juden fühlen sich zunehmend unsicher in Deutschland und nehmen die Entwicklung als bedrohlich war. Diese Entwicklung geht auch die christlichen Kirchen etwas an, umso mehr, als sie an vielen Stellen aus der Vergangenheit gelernt hat und sich von alten Denkmustern zunehmend verabschiedet hat. Damit sollte sie gesellschaftlich eine Vorreiterrolle einnehmen und dadurch ihrem oft noch proklamierten Selbstbild als Volkskirche entsprechen.
Antisemitische Einstellungen, Stereotype und Sprache sind in der deutschen Mehrheitsgesellschaft wie in der evangelischen Kirche nach wie vor virulent. Gerade ein sogenannter israelbezogener Antisemitismus beziehungsweise antizionistische Argumentationsstrukturen tauchen immer wieder in Beiträgen zum palästinensisch-israelischen Konflikt, auch in kirchlichen Medien und Diskussionen, auf. Gleichzeitig lassen sich gegenläufige Entwicklungen aufzeigen. So sind die evangelischen Kirchen seit 1945 einen weiten Weg gegangen. Der Rheinischen Landeskirche kommt in dieser Geschichte mit dem bereits zitierten Synodalbeschluss eine besondere Rolle zu. Die Absage der EKD an die Judenmission hilft, das Verhältnis von Juden und Christen theologisch neu zu bestimmen und damit auch für den Jüdisch-Christlichen Dialog eine neue Basis zu schaffen.
Es sollte daher umso mehr alarmieren, wenn sich jüdische Gesprächspartnerinnen und Gesprächsparnter aus einem guten und langen Gespräch, wie es etwa die Rheinische Landeskirche jahrzehntelang geführt hat, zurückziehen, weil sie die missverständlichen Passagen eines Textes nicht wohlwollend lesen können. Kirche und Gesellschaft sollten darauf reagieren, wenn jüdische Menschen stärkeren Schutz einfordern. In einer Zeit, in der sich wieder vieles für Jüdinnen und Juden zum Schwierigeren in Deutschland und Europa verändert, ist es dringend notwendig, aus der abstrakten und nicht neuen Feststellung, dass Kirche(n) und Theologie leicht auf antisemitische Strukturen aufsetzen, neue Verhaltensweisen im Umgang mit den jüdischen Geschwistern abzuleiten und diese umzusetzen.
Deutlich wird am Düsseldorfer Fall zweierlei: Wir brauchen weiterhin eine Debatte über Antisemitismus in Deutschland und in der Evangelischen Kirche und wir brauchen eine Kultur der praktischen und selbstkritischen Solidarität mit Jüdinnen und Juden. Wie wäre es anzuerkennen, dass judenfeindliche Sprache und Stereotype so tief in unseren Traditionen verwurzelt sind, dass es passiert, dass wir in solch verletzender Sprache reden, auch wenn wir nicht überzeugte Antisemiten sind? Wie wäre es, in der Folge, Hinweisen auf dieses problematische Sprechen nicht mit abwehrenden Erklärungen und Zurückweisungen, sondern als wertvolle Kritik dankbar aufzunehmen? In einer Zeit, in der der deutsche Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden, von Christinnen und Christen mitverübt und von den christlichen Kirchen akzeptiert, wieder öffentlich kleingeredet werden kann und in der es eine Gefahr ist, als Jude oder Jüdin in der Öffentlichkeit erkennbar zu sein, würde es denjenigen, die diese Verhältnisse für untragbar halten, gut stehen, auch ihr Sprechen über Israel daran messen zu lassen, ob diese Überzeugung für jüdische Menschen verständlich ist.
Der Verweis auf ein strukturelles Antisemitismusproblem der Kirche ist richtig, er darf aber die Möglichkeit praktischer Solidarität nicht dadurch verhindern, dass er das Problem als allein spezifisch kirchlich-theologisches abstrahiert. Hannes Leitlein kritisiert in „Christ & Welt“ die Unsicherheit, die die Kirche im Umgang mit Antisemitismus immer noch spüren lasse. Etwas mehr Unsicherheit wäre vielleicht aber ein guter Anspruch für Kirche und Gesellschaft, vor allem dann, wenn sie sich korrigieren und aufmerksam machen lässt, ohne in Abwehr zu verfallen.

Auf evangelisch.de ist ein Gastbeitrag unserer Mitglieder Milena Hasselmann und Maria Coors erschienen: »Gegen Antisemitismus: Praktische Solidarität statt abstrakte Vorwürfe«:
»Wir brauchen weiterhin eine Debatte über Antisemitismus in Deutschland und in der Evangelischen Kirche und wir brauchen eine Kultur der praktischen und selbstkritischen Solidarität mit Jüdinnen und Juden.«
Den Beitrag können Sie auf den Seiten von evangelisch.de lesen.